HanfBlatt, November 2004
„Die soziale Realität muß die Normen durch Lächerlichkeit aushebeln“
Eine Unterhaltung zwischen Professor Sebastian Scheerer (S.), dem netten Kriminologen an der Universität Hamburg und den zwei unverdrossenen Mitarbeitern des HanfBlatt, AZ (A.) und Jörg Auf dem Hövel (J.).

J.
Sie weilten eine Zeit in Brasilien?
S.
Richtig. Bei einem Treffen mit einem Landtagsabgeordneten der Grünen Partei, Tota Agra, der aus einer Region im Nordosten Brasiliens kommt, in welcher traditionell Cannabis angebaut wird, ging es auch um den Faserhanf. Ich zeigte ihm Hanfprodukte aus Europa, die hier ja keine so große Besonderheit mehr, dort aber nahezu unbekannt sind. Hanfjacken, Mützen, Hemden, Hanföl und so weiter. Während einer Drogenkonferenz in Sao Paulo stellte er diese Produkte im Foyer aus – das kam riesengroß. Von großen Interesse wäre für ihn garantiert die holländische Grower-Szene. Ich hätte schon Lust mich in dieser Hinsicht einzumischen, aber nach meinem Forschungssemester ist die Zeit knapp. Jetzt steht die Lehre hier in Hamburg im Vordergrund. Ich bin also gar nicht „up to date“ was die Vorgänge in Deutschland angeht. Ist die Kriminalisierung der Cannabis-Samen eigentlich schon durch?
A.
Die ist seit dem ersten Februar Gesetz. Viele Händler haben ihre Samen schon aus dem Angebot genommen, andere verkaufen offen weiter, manche verkaufen Vogelfutter. Contact your local Bird-Shop.
S.
Am Spritzenplatz in Hamburg-Altona gab es einen Grow-Shop, ich weiß nicht, ob Sie den kennen?
J.
Doch, doch, ich wohne da um die Ecke.
S.
Hat der wegen des Samenverbots dicht gemacht?
A.
Ich glaube, der hat sich nicht etablieren können oder ist umgezogen. Es sprießen weiterhin Grow-Shops aus dem Boden.
S.
Und Coffie-Shops? Vor zwei Jahren gab es ja etwa 15 Stück in Hamburg.
A.
Heute eher mehr.
J.
Ich würde schon auf dreißig Stück im Hamburger Stadtgebiet tippen.
S.
Und was ist mit Rigo Maaß passiert?
A.
Nichts mehr gehört. Wenn man sich in diese rechtliche Grauzone begibt, hat man es ja nicht nur mit der Polizei zu tun, sondern auch mit Konkurrenz, mit Leuten die denken, daß hier viel Geld verdient wird. Die kommen dann eventuell auch mal vorbei und wollen was abhaben von dem Kuchen. Zum Teil gibt es ja auch Versuche, das Ganze zu monopolisieren.
J.
Die Coffie-Shop-Szene in Hamburg ist weitgehend in türkischer Hand. Zweieinhalb bis drei Gramm Gras für fünfzig Mark.
S.
Die werden aber mit fünf Gramm ausgezeichnet?
J.
He, he, he.
A.
Teilweise ist es auch mehr. Das geht bis vier Gramm hoch. Die Qualität ist auch unterschiedlich. Bei einigen ist es oft ein dröhniger Skunk, bei manchem anderen hat man schon eine richtige Auswahl, bis hin zu einer Tafel, die mehrere Sorten Hasch oder Gras anbietet.
J:
Es ist ja sehr einfach geworden, Gras anzupflanzen. Mit vier Lampen hat man schnell eine Überschußproduktion, die sich gut über den Laden eines Bekannten vertreiben läßt. Das Geschäft floriert.
A.
Überhaupt haben ja alle Drogen in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Cannabis im Rahmen von Grunge, Hip-Hop, Jungle, Dub, Schlager, House und Techno. Fast alle Jugendkulturen haben Cannabis integriert, in manchen kommen dann andere Drogen dazu. Bei den einen Speed, bei den anderen Koks, bei den nächsten LSD oder Ecstasy. Cannabis scheint überall die Basis.
S.
Auch eine ideologische Basis.
A.
Das Wissen um den Hanf ist ebenfalls schnell gewachsen. Saatgut, Lampen, Erde, Anbau, Wirkung der Droge, darüber wußten die Leute früher nicht so gut Bescheid.
J.
Wäre interessant bei Philips oder Osram nachzufragen. Die müssen unglaubliche Absatzsteigerungen verbuchen.
A.
Letztendlich profitieren ganz seriöse Unternehmen davon. Lampenhersteller,
J.
Düngemittelindustrie,
S.
Steinwollehersteller
A.
Pumpenhersteller. Oder die Firma Steimel, die einen Heißluftfön produziert, der ideal zum verdampfen von Gras ist. Die wollen sicher nicht damit in Verbindung gebracht werden, werden sich aber trotzdem die Hände reiben, daß Tausende Kiffer ihren Fön im Baumarkt kaufen.
S.
Jetzt habe ich Sie ja hauptsächlich befragt. Worüber wollen wir denn sprechen?
J.
Ach, daß kann ruhig so weitergehen. Aber ich habe mich gut vorbereitet und einige Fragen notiert. Kann ich Sie nach einem Resümee der Kohl-Ära in Bezug auf die Drogenpolitik fragen?
S.
Warum nicht. Die Kohl-Ära begann 1982 mit der sogenannten „Wende“.
A.
Steinlange her.
S.
Zwei gegensätzliche Strömungen konnten in der Kohl-Ära beobachtet werden. Auf der Ebene der internationalen Konventionen und der Regierungspolitik ist alles schlimmer geworden. Man hat 1988 die Konvention von Wien beschlossen, die zu einer weiteren Verschärfung der Drogengesetze geführt hat. In der Bundesrepublik wurden Anti-Drogen Kampagnen ins Leben gerufen, wie „Keine Macht den Drogen“. Es kam zu einer Ausweitung des sachlichen Geltungsbereichs, wie die Juristen sagen: Immer mehr Substanzen wurden kriminalisiert. Auf der anderen Seite gab es aber eine reale Entwicklung, in die entgegengesetzte Richtung. Es wurde alles viel besser! Die Verfügbarkeit von Drogen ist sehr viel größer geworden. 1982 gab es noch nicht dieses differenzierte Angebot.
A.
Kokain war exklusiven Kreisen vorbehalten. Heute kostet es ein Viertel soviel wie damals.
S.
In der Jugend hat Cannabis einen Aufschwung genommen. Anfang der 80er Jahre war das die Droge der 68er, der alt werdenden Hippies. Inzwischen hat es wieder ein junges Image bekommen. Meine Neffen und Nichten, 15 Jahre alt, nehmen das und sind alle begeistert. Auch über die Symbolik, über die Blätter, darüber, Zuhause so eine Pflanze zu haben. Die Sichtbarkeit der Zubehörindustrie war in den 80ern natürlich auch nicht so ausgeprägt wie heute. Insgesamt kann man sagen, daß Drogen wieder „in“ sind, vor allem bei der jungen Generation. Man kann also in der Zukunft Gutes erwarten. Und das alles unter der Herrschaft eines konservativen Kanzlers und einer Gesetzgebung, die immer mehr an der Realität vorbeiläuft.
J.
Die SPD stand 1982 ebenfalls noch auf einem ganz restriktiven Standpunkt.
S.
Da gab es einen Konsens zwischen Union und SPD. Es gab nur eine Drogenpolitik und die hieß „draufhauen“. Erst später haben sich anläßlich der Methadonfrage und des Besitzes kleiner Mengen von Drogen zwei Richtungen in der Drogenpolitik entwickelt. Auch die Spaltung zwischen Bundespolitik und einer immer selbständiger agierenden Landespolitik fällt in diese Zeit. Die Vorstellung, daß Kommunen eine eigenständige Drogenpolitik machen, gab es Anfang der 80er Jahre noch nicht.
J.
Was ist von einer Regierung mit einem Kanzler Gerhard Schröder zu erwarten?
S.
Tja, ich erwarte da nicht soviel. Die Jusos hatten eine Zeitlang einen sehr rührigen drogenpolitischen Sprecher, Jürgen Neumeyer. Sehr kompetent. Die SPD selbst aber ist komplett puritanisch: anti-alkoholisch und ohne andere Drogen soll es durchs Leben gehen. Die Arbeiterbewegung war noch nie besonders hedonistisch oder post-materialistisch. Die Arbeiter sollen ja fleißig arbeiten und abends noch zum Ortsverein und Protokoll schreiben!
J.
Der aktuelle drogenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag ist Johannes Singer. Und der meint, daß es in einer Gesellschaft keinen vernünftigen Umgang mit Drogen geben kann.
S.
Geschäftsgrundlage des Regierungswechsels ist ja, daß sich nichts grundlegend ändern wird. Es heißt, daß wenn Wahlen was bewirken würden, sie schon lange verboten wären. Dieses Jahr habe ich den Eindruck ganz besonders.
J.
Auf die Grünen/Bündnis 90 kann man auch nicht setzen.
S.
Sehe ich genau so. Da gibt es ja auch sehr schlimme Frustanbeter. Zum Teil herrscht die Einstellung: Naturdrogen gut, Chemiedrogen schlecht. So ein Blödsinn!
A.
Manche Chemiedrogen entpuppen sich als Naturdrogen. Jüngst wies man Amphetamin in einer Akazienart nach. Damit ist auch das Amphetamin, welches als die klassische Chemiedroge galt, im Grunde eine natürliche Substanz. Unser Körper produziert auch Benzodiazepine, damit ist Valium praktisch körpereigen.
S.
Wie man sieht also eine sehr oberflächliche Theorie. Ich schreibe auch lieber mit künstlichen Kulis als mit natürlichem Blut.
A.
Wenn chemische Drogen was bewirken, sind sie ja den körpereigenen Drogen meist sehr ähnlich. Und letztendlich ist die Natur unteilbar, auch was wir in den Chemielabors herstellen gehört zur Natur, nicht nur der Nationalpark Wattenmeer.
S.
Zudem herrscht bei den Grünen noch eine Tradition, die sich gegen eine von außen herbeigeführte Bewußtseinsveränderung stellt. Bewußtseinsveränderung ist danach nur Vernebelung oder Flucht. Die größten Greueltaten der Geschichte werden aber von nüchternen Leuten begangen, nicht von Kiffern.
J.
Krista Sager von der GAL, zweite Bürgermeisterin in Hamburg, wäre ja ein Gegenbeispiel. Sie äußerte, daß die meisten Techniken zur Bewußtseinsveränderung der staatlichen Kontrolle entzogen sind. Sie macht Yoga…
S.
Na ja, sind ja nicht alle blind und blöd, und vielleicht stellen die Grünen in den Koalitionsverhandlungen einige Forderungen in Richtung auf eine vernünftige Drogenpolitik.
A.
Auch die SPD-regierten Länder stimmten dem Gesetz vom 1. Februar zu, das zwar die Verschreibung von Methadon erleichterte, zugleich aber Cannabis-Samen und andere Pflanzen, wie Pilze und Stechapfel illegalisierte, wenn sie denn der Berauschung dienen. Eine weitere Kriminalisierung des Natürlichen.
J.
Ein Schummel-Paket.
A.
Eine heuchlerische Einstellung, die auch für die Zukunft nichts Gutes erwarten läßt.
S.
Meine Hoffnung liegt für die Zukunft weniger in einer wie immer gefärbten Bundesregierung, sondern in einer autonomen Drogenpolitik der Bundesländer. Vor Ort geht es doch darum, die Probleme zu lösen und nicht durch weitere Repressionen weitere Probleme zu schaffen. Eine Fortsetzung der Spaltung zwischen Regierungsrethorik und Gesetzgebung einerseits und tatsächlichen Lebensverhältnissen andererseits wäre nicht das Schlechteste. Die soziale Realität muß die Normen durch Lächerlichkeit aushebeln.
J.
Wie sind die Gerichte in diesem Zusammenhang einzuordnen?
S.
Die spielen eine enorme Rolle. Es gibt ja Gesetze, die einfach nicht durchgeführt werden. Im Falle des Abtreibungsparagraphen 218 hat man jahrelang keine Prozesse gegen Frauen geführt, die abgetrieben haben. Es kam dann zum Skandal, als in Memmingen das erste Mal das Gesetz durchgeführt wurde. Wenn die Gesellschaft es immer lächerlicher findet, mit der Polizei hinter Graskonsumenten hinterherzulaufen, werden auch die Gerichte und die Staatsanwaltschaft das tiefer hängen. Jeder der in Hamburg oder anderen liberaleren Bundesländern in eine Polizei-Kontrolle geraten ist, kann ja davon berichten, daß die Beamten nicht mit aller Schärfe des Gesetzes gegen Kiffer vorgehen.
J.
Wenn man Zeitungen aus Süddeutschland verfolgt, sieht das ganz anders aus.
A.
Und in Sachsen geht die Polizei sehr streng vor. Dort hat sich vor allem Cannabis schnell verbreitet. Theo Baumgärtner befragte in einer Studie Dresdener und Leipziger Studenten. Die sind mittlerweile auf dem selben Genuß-Niveau wie die deutschen Kommilitonen. Und immerhin hat das Landeskriminalamt Sachsen vor kurzem ein Abonnement des HanfBlatt geordert.
S.
Ha, ha, ha.
J.
Sehr schön. Ein kleiner Themensprung: Die große Zeit des Coming-Out von Schwulen ist ja vorbei, wohl auch, weil es unspektakulär geworden ist. Folgt irgendwann das Coming-Out der Wissenschaftler und Drogenforscher, ob und welche Substanzen sie selber genießen?
S.
Ein schwuler Kollege, auch Kriminologe, veröffentlichte gerade einen Artikel, in welchem er darauf hinweist, daß er im Jahre 1984 auf Seite soundso eines Buches geschrieben hatte, daß er schwul ist. Die Drogenforscher in der Kriminologie haben das noch nicht geschafft zu sagen, was sie wann nehmen. Das Coming-Out läßt hier noch auf sich warten. Nun muß man aber sagen, daß 1984 die Homosexualität schon Jahre lang entkriminalisiert war und wir wohl erst die Zeit nach der Freigabe mit einem wunderschönen Sammelband rechnen dürfen, mit dem Titel „Drogenforschende Rauschgiftesser erzählen“ – oder „Rauschgiftessende Drogenforscher“ !?! Da gibt es doch lustige Geschichten. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal mit einigen weltberühmten Legalisierern in einer eleganten Hotelsuite saß und die Utensilien für einen Joint immer weiter gereicht wurden, weil keiner in der Lage war einen Joint zu drehen. Extrem peinliche Sache.
A.
Ich bevorzuge als Nichtraucher auch die Pfeife. Grundsätzlich wünsche ich mir, daß man offen über die positiven und negativen Seiten -die ja alles hat- diskutiert. Und jeder ist ja unterschiedlich, dem einen gefällt die Droge nicht, dem anderen gefällt sie halt. Ein Abend mit Bier kann auch in einer Katastrophe enden. Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, sind die meisten Substanzen nicht so gefährlich, wie sie in den Medien und der Anti-Drogen Propaganda dargestellt werden. Mit einem ehrlicheren Dialog ist auch den Gefährdeten besser geholfen.
S.
Es gibt ja selbst unter Wissenschaftlern die Unsitte, den Verteufelungsdiskurs einen Schönwetterdiskurs entgegenzusetzen. Nach dem Motto: Cannabis ist völlig ungefährlich. Das eine ist so unhaltbar wie das andere.
J.
Was dem Coming-Out von Forschern ja entgegensteht ist ein Problem, welches schon in der wissenschaftlichen Diskussion um LSD in den sechziger Jahren virulent war. Da konnte man als Forscher irgendwann nicht mehr zugeben, daß man selber Kontakt zu der Droge hat, weil die Fachkollegen die Objektivität in Frage gestellt haben.
A.
Die Erfahrung sollte -so der Vorwurf- die Rationalität für den Rest des Lebens in Frage gestellt haben. Schubladen sind halt sehr hilfreich. Ich habe Sie vor einigen Jahren bei einer Diskussion mit Sozialarbeitern erlebt, in welcher es um Kokain ging. Da haben Sie die relative Harmlosigkeit von Kokain herausgestellt.
S.
Das kam nicht so gut an.
A.
Stimmt. Die Sozialarbeiter haben ja ihre Klientel, ehemals Heroinabhängige, substituierte Methadonkonsumenten. Deren Sucht ist ja nicht mit einer Substanz zu heilen. Viele Leute haben ihre Schwierigkeiten auf Kokain verlagert, das sie nehmen, um ihren Kick zu kriegen und sie klauen und prostituieren sich nun, um Kokain zu kaufen. Für die Sozialarbeiter ist da jetzt Kokain der Dämon. Die sehen nicht die zahllosen von Freizeitkonsumenten, die mit der Droge umgehen können.
S.
Wenn ich mit stationär behandelten Alkoholikern zu tun habe, dann habe ich auch ein anderes Bild von Alkohol, als wenn ich und mein Freundeskreis ab und zu am Abend Wein genieße. Man müßte die Ambivalenz dieser Drogen und die Bedeutung des richtigen Umgangs mit ihnen klar machen und einüben. Und das muß bei den Kindern beginnen. Es kann ja nicht sein, daß einem ausgerechnet vom Staat ein bestimmter Lebensstil vorgeschrieben wird. Es gibt ein wunderbares philosophisches Buch dazu. Es handelt sich um „Drugs and Rights“ von Douglas N. Husak.
J.
Zurück zur Forschung. Die Diskussion hakt ja auch an dem Umstand, wie Wissenschaft heute immer noch betrieben wird. Da steht auf der einen Seite der Forscher und auf der anderen Seite das Objekt seiner Betrachtung. Den Rausch nur anhand objektiv feststellbarer Veränderungen der Transmitterausschüttungen im Gehirn zu analysieren ist eine Sache. Der interpretative Weg, was das für das einzelne Individuum bedeutet, ist doch was ganz anderes, sollte aber meiner Meinung nach als gleichberechtigter Forschungsbereich neben der objektiven Betrachtung stehen.
S.
Der Nachfolger von Professor Schmale im Institut für Psychologie an der Uni Hamburg, hat vor kurzem eine Tagung veranstaltet mit dem Titel: „Introspektion als Forschungsmethode“. Man katapultiert sich ja nicht automatisch aus der Wissenschaft heraus, wenn man über sich selber nachdenkt und versucht, sich selber zu erkennen. Im Gegenteil, daß ist eine legitime Quelle des Wissens und ich muß halt auch hier sehen, welche Methoden ich dazu anwende. Die Betroffenenperspektive hat ein Potential, mit der man in Ecken von Realität kommt, die anderen verborgen bleiben.
A.
Es kursiert ja der Verdacht, daß Drogengegner und Prohibitionisten nicht bereit sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Dieser These nach unterdrücken sie etwas in sich, was sie dann in die Außenwelt projizieren um dann dort andere Menschen für ihr abweichendes Verhalten bestrafen zu wollen.
S.
Plausibel.
J.
Die Systemtheorie glaubte ja schon, die Subjekt-Objekt Trennung überwunden zu haben, indem sie alles als ein großes Gewebe betrachtet, was miteinander verbunden ist. Gleichwohl betrachtet sie die Welt als Objekt und fragt nach Funktionen. Als Beispiel fragen sie nach der Funktion des Drogenkonsums bei Indianern im Regenwald. Sie entdecken dann, daß dies die Gemeinschaft zusammenhält, soziale Spannungen löst und so weiter. Wenn man sich dagegen als teilnehmender Beobachter in die Stammesgemeinschaft begibt, wird man gänzlich anderes entdecken, beispielsweise, daß hier die Verbindung zur Natur, Verstorbenen Mitgliedern oder höheren Wesen gesucht wird.
S.
Da sagt dann die Perspektive von draußen mehr über den Beobachter als über das Beobachtete.
A.
Deutlich wird das ebenfalls bei Reiseliteratur. Die sagt oft mehr über die psychische Verfassung des Reisenden aus, als über die Menschen, denen er begegnet. Der Forscher schützt sich durch seine Methoden vor dem Chaos, dem Tumult, in den er sich begibt. Er notiert Namen, sortiert Beziehungen, katalogisiert alles, was ihm in die Quere kommt.
S.
Angst. Unter Wissenschaftlern gibt es mehr Angst als auf der Achterbahn. Es gibt ein viel zitiertes und heute immer weniger gelesenes Buch von George Devereux, „Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften“, der diesen Zusammenhang gut aufbereitet.
A.
Wenn man es auf die Spitze treibt, kann man fast sagen, daß Wissenschaft in dieser Form was Zwanghaftes hat. Der zwanghafte Wunsch, die Welt zu kontrollieren, in Systeme zu zwängen und dort zu halten.
J.
Cannabis als Medizin. Da wird jetzt viel geforscht und so kommt Bewegung ins Spiel.
S.
Eine gute Entwicklung. Und nur ein Beispiel dafür, daß die Betäubungsmittelgesetzgebung in vielfacher Hinsicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Selbst wenn man zugestehen würde, daß Drogen nicht zu hedonistischen Zwecken gebraucht werden sollten, sagen doch die internationalen Konventionen, daß sie selbstverständlich die Befriedigung des medizinischen Bedarfs garantieren sollen.
A.
Da steckt eine verrückte Ideologie hinter. Die Natur bietet ein Konglomerat von Substanzen und im Cannabis tummeln sich über 500 verschiedene Inhaltsstoffe. Warum man nun nur das reine THC anwenden darf, ist doch völlig unklar. Gerade die anderen Inhaltsstoffe nehmen dem THC einen Teil der möglicherweise unangenehmen Nebenwirkungen. Es gibt Jahrtausende alte Erfahrungen mit der Pflanze Cannabis.
S.
Das ist dieses auf die Spitze getriebene analytische Denken.
A.
Da hat man Milligramm, rechts-oder linksdrehend und dann ab in die Kapsel.
J.
Und dahinter stecken auch finanzielle Interessen der Pharma-Industrie.
S.
Eine absurde Idee, Dinge, die seit Jahrtausenden zu medizinischen, sakralen oder hedonistischen Zwecken genutzt werden, einfach zu verbieten und allen Ernstes zu erwarten, daß alle Menschen auf der Erde sich daran halten.
Da werden Gesetze geschaffen und später muß man sehen, wie man die Folgen dieser Gesetze durch neue Gesetze in den Griff kriegt. Eine Flut von Verordnungen ist die Folge. Und irgendwann hat man sogenannte Drogengelder, die durch den Verkauf von Drogen eingenommen wurden. Wenn ich bei ALDI meinen Wein kaufe sind das ja auch keine Weingelder, bei Käse kein Käsegeld. Zu sagen, alles Geld was mit dem Drogenhandel in Beziehung steht, ist kriminell erwirtschaftet, ist Hexenverfolgung pur. Und wie wahnsinnig es ist, begreift man nur deshalb nicht mehr, weil es herrschende Ideologie ist. Doch die Realität bewegt sich von den Normen weg. In Richtung, Autonomie, Differenz, Pflege des Selbst und der Solidarität unter Drogennutzern. Das schafft viel positive Energie.
J.
Ein gutes Schlußwort. Danke sehr für das Gespräch.

 Die US-Regierung geht nicht besonders hart gegen diese Substanzen vor. Warum, denkst du, greift der Staat hier nicht stärker durch?
Die US-Regierung geht nicht besonders hart gegen diese Substanzen vor. Warum, denkst du, greift der Staat hier nicht stärker durch?

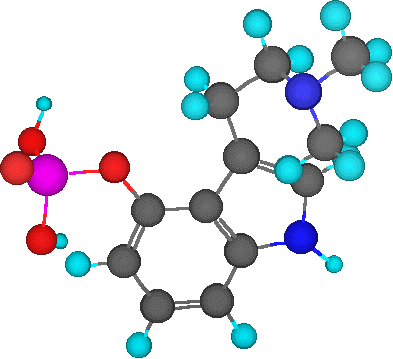
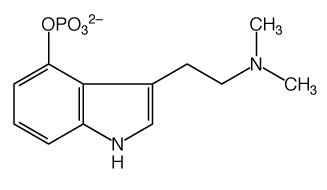
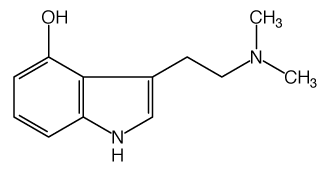

 Ein Beispiel: So erstritten ein Hersteller einer Margarine die Eintragung der Wortmarke „Du darfst“ ins Markenregister und eine Firma für Haushaltsgeräte den Begriff „Zisch & Frisch“. Die Richter waren der Meinung, dass „Du darfst“ eine unvollständige Aufforderung darstellte, deren gedankliche Ergänzung durch den Kunden den Kriterien des „phantasievollen Überschusses“ entsprach. Im Urteil zu den Küchenmaschinen machte die Lautmalerei des „Zisch“ in Zusammenhang mit dem „Frisch“ bei den Richtern Eindruck. Im selben Jahr (1997) hatten der 26. Senat des hohen Gerichts allerdings den Slogan „IS EGAL“ abgeschmettert. Da fragte sich der abgewiesene Getränkeabfüller, wenn „Du darfst“, warum „IS“ das dann nicht „EGAL“?
Ein Beispiel: So erstritten ein Hersteller einer Margarine die Eintragung der Wortmarke „Du darfst“ ins Markenregister und eine Firma für Haushaltsgeräte den Begriff „Zisch & Frisch“. Die Richter waren der Meinung, dass „Du darfst“ eine unvollständige Aufforderung darstellte, deren gedankliche Ergänzung durch den Kunden den Kriterien des „phantasievollen Überschusses“ entsprach. Im Urteil zu den Küchenmaschinen machte die Lautmalerei des „Zisch“ in Zusammenhang mit dem „Frisch“ bei den Richtern Eindruck. Im selben Jahr (1997) hatten der 26. Senat des hohen Gerichts allerdings den Slogan „IS EGAL“ abgeschmettert. Da fragte sich der abgewiesene Getränkeabfüller, wenn „Du darfst“, warum „IS“ das dann nicht „EGAL“?

