Jörg Auf dem Hövel
Abenteuer Künstliche Intelligenz
Auf der Suche nach dem Geist in der Maschine
Auszug aus Kapitel 5:
Zivilisationshype: Amerikanische
Träume
Was die Forscher am MIT so stark macht und was sie in die Irre treibt. Mit
Joseph Weizenbaum in der Hotellobby.
Die Fahrstuhltür schiebt auf und heraus kommt ein rotes Tuch. Einigen Autoritäten schwillt der Kamm, wenn das Gespräch zu ihm und seinen Ansichten führt, andere halten ihn für die Kassandra eines Fachbereichs, wieder andere erheben ihn zu dem KI-Philosophen, weil er die Amoralität einer Branche aufgedeckt. Die wenigsten aber winken gelangweilt ab, denn der Mann ist eine lebende Legende, einer der wenigen Gelehrten der Informatik und Künstlichen Intelligenz, der weit über die Grenzen des Forschungsgebiets prominent ist. Dementsprechend werfe ich mich in der Hotellobby verbal auf die Knie, was ihn mehr irritiert denn kalt lässt. Er hilft mir auf, ich stammle noch was von "eine Ehre Sie hier zu treffen...", dann gehen wir zur Sitzgruppe über.
Mir gegenüber sitzt Joseph Weizenbaum, unter dessen Namen in Fernsehinterviews oft das Wort "Computerpionier" flackert - er arbeitet bereits 1955 am ersten Computersystem für die Bank of America mit. Als er zwischen 1964 und 1966 die Tastatur-Psychaterin ELIZA programmiert ahnt er nicht, dass selbst einige seine Kollegen das Programm für voll nehmen werden. Der Schock darüber wirkt bis heute nach. Eine Maschine mit menschlichen Eigenschaften? Das ist für Weizenbaum seit ELIZA nur ein Kategorienfehler des Betrachters.
Wir wärmen uns mit einen Plausch über den letzten Streifen von Steven Spielberg auf, der den programmatischen Titel "A.I." trägt. "Etwas über A.I. lernen kann man durch den Film nicht, es geht um eine rührige Mutter-Kind Beziehung", ärgert sich Weizenbaum. Ich frage nach der vorbehaltlosen Liebe gegenüber seiner menschlichen Mutter, die dem Jungen einprogrammiert ist, Weizenbaum lächelt neckisch: "Ach, wissen Sie, bedingungslose Liebe, die haben wir ja bereits in dieser Welt: Wir nennen es Hund. Ob wir das noch mal als künstliches Produkt brauchen? Ich bin da unsicher."
Das Schlagwort der Künstlichen Intelligenz wird seit der historischen Konferenz 1956 in Dartmouth von einem Glatzkopf visualisiert, an dem sich alle behaarten Antagonisten reiben können, Marvin Minsky. Um es vorweg zu nehmen: Vieles, ja, fast alles, was heute von den Primadonnen der Künstlichen Intelligenz wie Hans Moravec und Ray Kurzweil als neue Hauptspeise auf der Menukarte publiziert wird, ist eine aufgewärmte Suppe, welche der Meisterkoch des Posthumanismus schon vor 40 Jahren erhitzt hat.
Um ehrlich zu bleiben, ja, dieses Kapitel will ihnen diese Suppe versalzen, sich der Demontage des Gerüsts widmen, das die sogenannten "KI-Päpste" hochgezogen haben. Aber vielleicht kommt es ja ganz anders. Eine Demontage kann auf zweierlei Wegen geschehen. Zum einen kann die Unmenschlichkeit der Entwürfe heraus gearbeitet werden; eine Aufgabe, der sich Ethik-Liebhaber wie der Mann in der Hotellobby verschrieben haben. Leider interessiert Ethik diese spirituellen Führer kaum. Darum ist es sinnvoll, sie dort abzuholen, wo ihre interne Logik greift, ihnen das Heimspiel anzubieten und mit ihnen gemeinsam das Match nach ihren Regeln zu spielen.
Gemeinsam mit John McCarthy gründet Marvin Minsky 1959 das KI-Labor am schon damals renommierten, zungenbrecherischen "Massachusetts Institut for Technology", kurz MIT. Ist die Wahl dieses Ortes Zufall? Nein, sie konnte gar nicht anders ausfallen. Schon ab dem 18. Jahrhundert ist der Bundesstaat Massachusetts mit seinen Universitäten in Boston und Harvard das geistige Zentrum Nordamerikas. Von dort aus predigt zunächst der Pfarrer Jonathan Edwards seine Philosophie, die im Anschluss an Augustinus alles Geschehen als "god´s acting" betrachtete. Später soll es wissenschaftlicher zugehen, und das MIT und die Philosophie des Pragmatismus erleben zusammen ihre erste Blüte. Es mutet seltsam an, dass sich kaum einer der frühen und heutigen MIT-Koryphäen der Tatsache bewusst ist, dass die Steine ihrer Universität mit dem heißen Geist der Philosophie eines William James gebacken sind.
Minsky und seine Nachfolger predigen die Anti-Philosophie, stellen jede Reflektion über Sein und Werden als okkulten Humbug dar, als ob nicht auch der Fluss ihre Sätze in das Bett einer sozialen Umwelt eingebettet ist. In einer rhetorisch fantastischen Umkehrung nennt Minsky Philosophie und Religion "einen Aberglauben", dessen Akzeptanz dazu führe, das man sich um die "Chance des ewigen Lebens" betrügen würde. Aber: Die gesamte technische Theorie der Amerikaner wurzelt tief in der Philosophie von William James, John Locke und David Hume, die ihrerseits wiederum in Francis Bacon wurzeln. Und dort, wo nix wurzelt, existiert zumindest eine Grundeinstellung, die in der Natur einen zu besiegenden Gegner sieht, der dem Planwagen-Treck des Fortschritts im Wege steht. Wer aber ist dieser William James?
Im Hörsaal herrscht dichtes Gedränge, Akademiker und Studenten,
aber auch interessierten Laien feiern den Philosophen William James wie einen
neuen Propheten. Nur 20 Gehminuten vom MIT-Campus entfernt, an der Harvard
Universität, hält James 1907 seine umjubelten Vorlesungen zum Pragmatismus.
Was ist es, was diese Denkschule so attraktiv macht? Hume hat es einmal in
aller wünschenswerten Klarheit ausgedrückt:
"Nehmen wir ein beliebiges theologischen oder metaphysischen Werk zur
Hand und fragen wir: enthält es irgendeine theoretische Untersuchung
über Quantität oder Zahl? Nein. Enthält es irgendeine experimentelle
Untersuchung über empirische Tatsachen? Nein. Nun, dann werfe man es
ins Feuer, denn dann kann es nur Sophistik und Spiegelfechterei enthalten."
Seither gleichen sich die bis zur Ermüdung wiederkehrenden Leitmotive des pragmatischen Denkens: Die Erfahrung ist der Koran, in dem alle Wahrheiten aufgezeichnet sind. Die wissenschaftliche Methode schlechthin ist dabei die Induktion, dass heißt der Schluss vom besonderen Einzelfall auf das allgemein Gültige, das Gesetzmäßige. Die Induktion ist die möglichst lückenlose Beweisführung, die alle Widerlegungen im Keim erstickt.
Eine Grundfrage der Philosophie, nämlich die nach der Wahrheit, beantwortet James forsch: Das Kennzeichen der Wahrheit sei ihre Nützlichkeit. Folglich sei Wahrheit die Summe dessen, was vom menschlichen Kollektiv als nützlich anerkannt worden ist. "Die verschiedenen Arten, wie wir empfinden und denken", sagt James, "sind so geworden, wie wir sie kennen, wegen ihres Nutzens für die Gestaltung der Außenwelt." Es ist schnell bemerkt worden, dass dieser Konzeption mehr als nur ein Hauch von Darwin anhaftet, sie läuft Gefahr, das Opportune für das Legitime zu halten. Ein Baum, so kann man den Pragmatismus verdichten, ist dazu da um uns Früchte zu schenken.
Ganz klar, in James und dem Pragmatismus verkörpert sich die Neigung der Neuen Welt zum Unmittelbaren, Gegenwärtigen und Praktischen. Zugleich wird ein markanter Charakterzug deutlich, den Hans-Joachim Störig "skeptische Unbefangenheit" nennt. Diese hält sich möglichst alle Optionen offen und ist zugleich immer bereit, die Möglichkeiten bis an ihr Ende zu denken. Es ist eben dieser stets nach vorne gerichtete "Westwärts!"-Optimismus, der die amerikanischen Wissenschaften so erfolgreich macht. Eng damit verbunden ist die Ablehnung der Herleitung der realen Welt aus irgendeinem grundlegenden Prinzip. Und wo kein grundlegendes Prinzip mehr herrscht, steht es dem Menschen frei, die Welt nach seinem Willen und seinen Kräften zu formen. Jedwede Intuition, das Gefühl, spielt für dieses Denken und die wissenschaftliche Erkenntnis keine Rolle. Das sind Blasen und Schäume, die im frommen Waschbecken zu blubbern haben, denn nach James haben die Gefühle nur eine Funktion: Sie führen zur Religion.
Und noch etwas liegt dieser Perspektive zugrunde: Das konstant und immer wirkende Prinzip einer linearen Kausalität, wonach jede Wirkung eine Ursache hat. Seine letzte Reinform hat dieses Prinzip, wie beschrieben, im Behaviorismus gefeiert. Input - Operation - Output sind die Modi einer Maschine, und es liegt gedanklich nahe, dass auch lebende Wesen nach diesem Schema funktionieren.
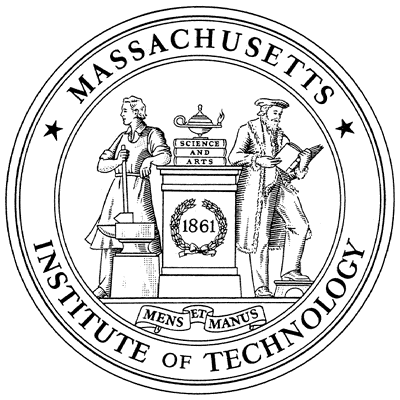
"Mens et Manus." Das von privaten und industriellen
Kräften finanzierte "Massachusetts Institute of Technology"
zeigt in seinem 1864 entworfenen Siegel, wohin die Reise gehen wird - Hand
und Hirn sollen fruchtbar zusammenarbeiten. Damit ist nicht nur die für
Europa ungewöhnliche enge Verbindung von Industrie und Wissenschaft symbolisiert,
in dem Logo lebt auch die cartesianische Trennung von Körper und Geist
weiter.
Über Minsky, heute über 70 Jahre alt, zerreißen sich seit
Beginn seiner Karriere die Medien das Maul. Dies liegt weniger an seinen wissenschaftlichen
Verdiensten, als vielmehr an seinen Sentenzen zur Zukunft der Menschheit.
Dabei könnte die Kluft zwischen den Leistungen seines MIT-Labors und
seinen Vorhersagungen nicht größer sein. Ende der 60er Jahre stellt
sein Team einem Roboter eine schlechterdings kinderleichte Aufgabe. Mit einer
Kamera und Greifarmen ausgerüstet soll die Maschine aus Bauklötzchen
einen Turm bauen. Die Forscher staunen selbige, als der Roboter mangels gesunden
Menschenverstands anfängt den Turmbau an der Spitze zu beginnen. Die
Verfolgung des programmierten Pfads führt zum ungenauen Ablegen der Klötze,
zudem haben die Kamera-Augen Probleme bei dem Erkennen von hinter- oder übereinander
liegenden Objekten. Der Fehlschlag hält Minsky nicht davon ab, vom Debugging
evolutionärer Fehlkonstruktionen im Menschen zu fabulieren. Und obwohl
seine Predigten abstrus erscheinen, frohlockt die junge KI-Gemeinde, setzt
Minsky ins virtuelle Papamobil und schiebt ihn durch die Straßen des
Erfolgs. Davon angespornt verstrickt er sich mit der Zeit in seinen flammenden
Reden immer tiefer in die Verkündung des Techno-Evangeliums. Was aber
erzählt der Mann?
Die Grundannahme Minskys ist die der sogenannten "harten KI": Zwischen dem Denken im menschlichen Hirn und der Informationsverarbeitung in der Maschine besteht kein Unterschied. Auf Basis dieser Prämisse klackert seit Geburt der klassischen, harten KI, ein Satz durch die Gebetsmühle: Die Konstruktion eines Maschinengehirns scheitert nur an technischen Unzulänglichkeiten.
Kollegenschelte ist unbeliebt und so hält sich Joseph Weizenbaum zurück.
Das Gespräch verläuft schleppend, was wohl daran liegt, dass er
fast alle meine Fragen an anderer Stelle schon einmal beantwortet hat, trotzdem
überlegt er vor jeder Antwort verdammt lange. "Wissen Sie",
fängt er an, "Marvin und ich sind trotz unserer Differenzen gut
befreundet, auch wenn er Lust auf seltsame Scherze hat. In einer öffentlichen
Podiumsdiskussion wurde er einmal gefragt, was er von einem gewissen Argument
von mir hält. Seine ernste Antwort war sinngemäß, dass man
zunächst einmal wissen muss, dass ich Kommunist sei". Weizenbaum
muss selber lachen, obwohl so eine Zumutung in den USA wahrlich kein Scherz
ist. Als Weizenbaum ihn später auf den Vorfall anspricht, winkt Minsky
nur lachend ab und sagt: "Ach, du kennst mich doch."
(...)
Aber zurück zum missionarischem Eifer des 21. Jahrhunderts. Es ist anzunehmen, dass die Utopie der totalen Beherrschung der Natur und des Menschen, wie alle bisherigen Utopien, nicht an ihren Gegnern, sondern an ihren eigenen Widersprüchen und ihrem Größenwahn scheitert. Auf der anderen Seite steht die Tatsache der technischen Evolution. Je mehr das technische Vermögen anwächst, um so selbstbewusster wird das ingenieurhafte Bewusstsein. Damit werden seit jeher die Fantasien beflügelt, welche die Metamorphose des irdischen Raums in eine perfekte, maschinale Ordnung anstrebt. Dass Gott, wenn es ihn denn gibt, ein Mathematiker sein muss, ist seit Platon Idee, seit dem 17. Jahrhundert technisch unterfütterte Überzeugung. Und das wiederum heißt, dass das Wesen der Welt nur in einem mathematischen Code aufbewahrt sein kann.
Der Einzug der maschinalen Ordnung in den Raum der Natur zeigt die stete Hoffnung, dass diese sich dem Zugriff der gestaltenden, gottähnlichen Potenz des Menschen nicht entziehen wird. "Tut sie aber doch", wird der Liebhaber natürlicher Wildnis jetzt einwenden, "und zwar vor allem dort, wo sich die Technik gegen die Natur stellt und sich nicht ihren Gesetzen anpasst." Aus Sicht der Techno-Utopiker ist das vorsintflutliches Wehgeschrei, mystisch angehauchtes Gejammer, denn ihr Plan ist bestechend: Man beachtet die natürlichen Gesetze, indem man sie benutzt, weiterentwickelt und anschließend überwindet. Sie entwerfen eine "Theologie des Schleudersitzes", der die Menschheit nicht nur aus ihren sozialen und ökologischen, sondern auch ihren spirituellen Bestimmungen rauskatapultieren soll.
Wenn auf der einen Seite die digitalen Evangelisten stehen, dann sind die ewigen Warner und Mahner, die stets behaupten, dass mit jeder neuen Entwicklung Sinnverlust und Uneigentlichkeit einher gehen, nicht weit. Aus obrigkeitsgeschwängerter Sicht gefährdet jedes neue Medium die Moral der Bürger. Vor der Lektüre von Romanen wird im 18. Jahrhundert ebenso vehement und mit denselben Argumenten gewarnt, die heute gegen das Fernsehen ins Feld geführt werden. Wohl gemeinte Ratschläge zur Bewahrung der Volksgesundheit sind die andere Seite. In einem frühen Fall von Technologiefolgeabschätzung warnt das "Königlich Bayrische Medizinalkollegium" um 1835 vor den Gesundheitsrisiken beim Benutzen der Eisenbahn. In dem Gutachten heißt es: "Ortsveränderungen mittels irgend einer Art von Dampfmaschine sollten im Interesse der öffentlichen Gesundheit verboten sein. Die raschen Bewegungen können nicht verfehlen, bei den Passagieren die geistige Unruhe, <delirium furiosum> genannt, hervorzurufen." Seither muss dieses Beispiel für die Irrungen der Fortschrittsbremser herhalten. Das Problem dabei ist nur, dass neuere Forschungen ergeben haben, dass dieses Gutachten nie existiert hat, sondern schon damals von den Befürwortern der Eisenbahn eingesetzt wurde, um die Gegner lächerlich zu machen.
Bei genauerer Betrachtung waren die damaligen Ängste vor der Eisenbahn nicht unbegründet: Bei einem der ersten großen Zugunfälle kamen bei Belleville in Frankreich 50 Menschen ums Leben, im Jahre 1889 wurden allein in Deutschland 602 Personen bei Eisenbahnunfällen getötet, in den USA waren es nicht weniger als 6000 Tote und über 29.000 Verletzte. Zugleich war die Eisenbahn die erste Maschine, die wirklich öffentlich sichtbar wurde. Die Dampfmaschinen in den Fabriken kannte man nur vom Hörensagen, mit der Lokomotive wurde die neue Zeit greifbar. Ihre Schnelligkeit, ihre schier unaufhaltsame, schienengeleitete Fahrt machten sie zum positiv wie negativ besetzten Symbol. Politisch stand sie für die einen für Demokratie und Republik, die sich unter Volldampf durchsetzen würden, für die anderen für die eiserne Unerbittlichkeit, die alle althergebrachten Traditionen überrollt.
Bis zur Aufklärung wird Technik ohnehin nicht als Menschenwerk, sondern infernalische Innovation abgelehnt. Bis in das 16. Jahrhundert hinein gelten Technik und Magie als weitgehend identisch. Mit Beginn der Industrialisierung ändern sich die Argumente. Dahinter steht zum einen oft die begründete Angst, durch den technischen Fortschritt den Arbeitsplatz zu verlieren, zum anderen sind es apokalyptische Urbilder, die in den Technikmäklern nach oben gespült werden. Hier wirkt das mythische Modell des Zauberlehrlings, der die herbeigerufenen Geister nicht mehr los wird. Das Prinzip der Furcht gleicht sich seitdem: Die technisch perfekte Maschine überholt und beherrscht ihren Erfinder, den imperfekten Menschen. Selbst Karl Marx benutzt Metaphern, die die Industrie als monströses Ungeheuer darstellen.
Das Schlagwort des "Maschinenstürmers" müssen sich heute alle diejenigen um die Ohren hauen lassen, die den ständigen Innovationen der Technik feindlich gegenüber stehen. Dabei ist bis heute umstritten, ob der "Maschinensturm", diese prügelnde Protestbewegung von Arbeitern in England und auf dem europäischen Kontinent, nur eine blinde Aversion gegen das Neue oder ein Protest gegen das System der maschinell gestützten Arbeitsteilung war. Wahrscheinlich beides. Fest steht, dass der Einzug der Maschinen in die Fabriken von den Arbeitern des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts nicht zwangsläufig als bedrohlich angesehen wurde. Die Opposition war erst dann besonders ausgeprägt, wenn die Meister, Unternehmer und Fabrikanten die Webstühle, Druckerpressen und Förderanlagen dazu nutzten, herkömmliche Qualitätsstandards zu senken und die Löhne zu drücken.
Auf der anderen Seite rüttelte die Kraft der Maschine an den vertrauten Statusgrenzen der ständischen Ordnung. Die spannende Frage von heute ist nun, welche Grenzen die Wissenschaft und Praxis von der maschinellen Intelligenz überschreitet. Auch ihr wird die Kraft zugesprochen (zu) schnelle Veränderungen herbeizuführen. Traditionen behindern nicht nur Fehlentwicklungen, sondern Entwicklungen überhaupt. Aber welche Traditionen sind in Gefahr? Aus Sicht der Kritiker stehen die humanistischen Traditionen auf dem Spiel, aus Sicht der Förderer nur der Größenwahn des Menschen, der nicht einsehen will, dass auch er nur ein wohl geordnetes Prinzip ist, eine chemisch-physikalisches Verfahren, das damit prinzipiell nachbaubar ist.
(...)