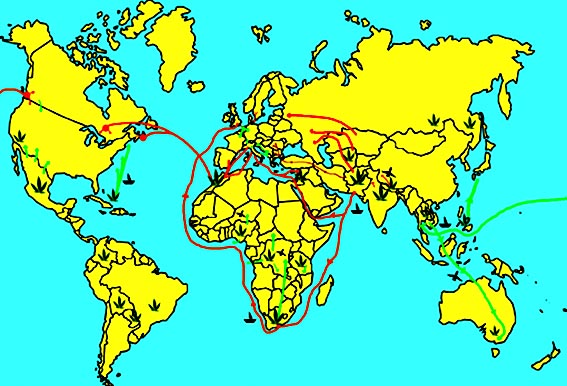HanfBlatt, Nr. 77, 2003
Dope auf dem Schulhof
Wie beliebt ist Cannabis unter Schülern? Und welche Folgen hat der Genuss?
Das Blech und die Scheiben von Philips roten Golf erzitterten unter den Klängen von Prince. Es war 1984 in irgendeiner Schule in einer Großstadt. In der großen Pause, ich glaube sie ging von halb bis um 11 Uhr, hatten wir es uns seit einem viertel Jahr zur Angewohnheit gemacht in der rostigen Karre zu verschwinden und eine Riesentüte zu rauchen. „Let´s go crazy“ dröhnte dann so laut aus den Magnat-Boxen, dass Passanten stehen blieben. Unsere Mitschüler, welche die Pause nutzen um aus dem nahe liegenden Penny-Markt Bier zu holen, die grienten nur wissend. Es war die Zeit in der uns endgültig klar wurde, dass Schule keinen Sinn macht, obwohl die Abiturprüfungen nahten. Cannabis stand dabei nie in dem Verdacht das Bewusstsein zu erweitern, wozu auch, wir wussten es ja eh schon besser. Die fetten Joints, die wir uns Tag für Tag reinzogen dienten keinem Ziel, sondern nur dem puren Amüsement. Wir wollten schnell und schmutzig leben, Mutti würde schon weiter zahlen.
Zeitsprung ins Jahr 2002: Eine Gesamtschule in Hamburg. Auf dem Schulhof tummeln sich die Racker, die älteren Schüler ziehen sich mit behördlicher Genehmigung eine seltsame Droge mit Namen „Tabak“ in der eigens dafür geschaffenen „Raucherecke“ rein. „Kiffer suchst Du?“, wiederholt einer der langen Kerls spöttisch und schaut mich von oben bis unten an. „Dann schau mal hinter das Gebäude dahinten. Vielleicht hast du Glück.“ Ich folge seinem Finger. Als mich die kleine Gruppe von Jungmännern sieht, nesteln sie in ihren Taschen rum. „Vom HanfBlatt, coool.“ Ja, sagen sie, „klar kiffen wir in den Pausen“. Jeden Tag? „Ooch ja, eigentlich ja.“ Nein, auf die Leistungen würden sich das nicht auswirken. „Der Unterricht ist sowieso völlig beschissen. Ob ich da breit bin oder nicht, dass macht keinen Unterschied.“ Die Hände in den Taschen, die Hosen in den Kniekehlen stehen sie da. Neuntklässler, die jedwedes Unrechtsbewusstsein beim Cannabisgenuss in die Tonne getreten haben. Für sie ist Kiffen Entspannungskultur, breit sein, high sein.
Das war 1984 nicht viel anders: Die Generation der Anti-Atomkraft-Bewegung mit ihren olivgrünen Parkern und ihren moralinsauren Eiertänzen hatte vor zwei Jahren die Schule verlassen, nun waren wir an der Macht. Wir, dass waren wilde Söhne und Töcher aus Beamtenhaushalten, welche die reduzierte Sprache von Albert Camus genossen und Jean Paul Satre lasen und ihn nicht verstanden. Es entwickelte sich eine Mischung aus krudem Existenzialismus und dem unbedingen Willen, dass Leben in vollen Zügen zu genießen. Techno war noch nicht erfunden, Acid-House war State of the Art und damit dämmerte langsam das Zeitalter des Hedonismus heran. Ohne es zu wissen waren wir die Vorläufer der heutigen Spaßgesellschaft. Wenn wir bekifft aus dem Auto zurück in den Unterricht flatterten, dann war Spaß garantiert – oder stumpfes rumdröhnen. Einmal kippte Philipp vom Stuhl vor Lachen, unser Biologielehrer (Typ: „Ich bin euer Kumpel“) schickte ihn entnervt zur Schulleiterin. Aber die Lehrer waren meist zu blauäugig, um unsere Zustände einzuordnen – oder sie wollten sie nicht sehen, weil wir seit der 11. Klasse den Unterricht eh nur noch für unser Privatscherzchen nutzten, mithin störende Elemente waren.
Tja, und nun die Preisfrage: Was hat das Cannabis mit uns getan? Um es mal mit den Maßstäben der Leistungsgesellschaft zu messen: Der eine Kiffer von damals kauft heute Fussballrechte in ganze Europa ein, der andere hat eine kleine Firma für Marktforschung gegründet, der dritte verdummt die Leute (er ist Angestellter in einer Werbeagentur), der vierte tut das ebenfalls, er schreibt diesen Artikel. Aber es gibt auch andere Wege: Einer aus unserem Kreise fand das Kiffen so großartig, dass er jeden Abend bedröhnt vor der Glotze hing, wir verloren ihn aus den Augen, Jahre später traf ich ihn wieder, er war ziemlich runtergekommen. Kaum jemand kommt auf die Idee, berufliche und private Erfolge am Graskonsum festzumachen, umgekehrt fällt das seit jeher einfacher. Und kaum jemand kommt auf die Idee die Fragestellung einmal umzukehren und eine Untersuchung darüber anzuschieben, welche Vorteile Jugendliche aus dem ja meist gemeinsam praktizierten Rauchritualen ziehen. Die Kiffen ein Problem sein muss, dies ist unausgesprochene Gedanken- und Finanzierungsgrundlage vieler Sucht- und Präventionsbüros.
Um es nicht falsch zu verstehen: Unser Konsum von Haschisch während der Schulzeiten hat die Leistungen in der Schule wahrlich nicht gefördert, im Gegenteil. Ab dem Moment der cannabioniden Intoxination waren wir bei körperlicher Anwesenheit freiwillig vom Unterricht ausgeschlossen. Letzlich waren wir das vorher zwar auch schon, aber nun gab es absolut keine Möglichkeiten für Lehrer und Lehrninhalte durch unseren Nebel aus Selbstgefälligkeit und Frohsinn durchzudringen. Nur hatten wir halt das Glück zu begreifen, dass man die Regeln des Systems irgendwann doch wieder befolgen muss, zumindest soweit, dass man nicht rausgeworfen wird. Die Eskapaden führten nie dazu den ideellen Reigen aus Eltern und sozialem Umfeld ganz zugunsten der hanfinduzierten Glückseeligkeit zu verlassen. Zudem hatten wir Glück, denn ein Lehrer stand dem Hanf nicht abgeneigt gegenüber. Wir teilten ein paar Züge lang unsere Erfahrungen. Der Mann hatte unser Vertrauen und war einer der wenigen Großgewachsenen, den man sich bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule offenbaren wollte.
Und was treibt der Hanfrauch heute aus dem Bewusstsein der SchülerInnen? Die sonore Stimme eines Hamburger Schulpsychologen dringt durch den Telefonhörer: „Ein großer Teil der Jugendlichen kann mit dem Cannabiskonsum umgehen, aber es gibt welche, die das nicht können. Wer zum Frühstück seine ersten Köpfe raucht, der hat schnell ein Problem.“ Der Mann kämpft mit mehreren Aufgaben: Ein Problem sei, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen, ob sich der Konsum unter den Menschen unter 18 Jahren tatsächlich erhöht hat. „Wir erhalten schon immer öfter Meldung von Schulen und Eltern, dass die Cannabis konsumierenden Schüler jünger geworden sind.“
Ob Eltern, Lehrer oder Schüler: Die Erfahrungen mit akut gedopten Mitschülern sind schlecht, darum ist man sich einig, dass der Genuss von Hanfkraut in der Schule nichts zu suchen hat.
Wo früher erst die 17-jährigen rauchen, kiffen heute zum Teil schon die 15-jährigen. Dieser subjektive Eindruck wird durch die letzten Erhebungen in Hamburg bestätigt. 1990 hatten insgesamt 27,9 Prozent und 1997 26,5 Prozent der 15 bis 39-jährigen jemals in ihrem Leben Cannabis probiert. Diese sogenannten „Lebenszeitprävalenz“ hat sich über die Jahre also kaum geändert. Aber: Deutliche Veränderungen zeigen sich bei der Gruppe der jungen Konsumenten. 1990 gaben nur 8,4 Prozent der 15-17-jährigen an, im letzten Jahr Hanf geraucht zu haben, 1997 waren das schon 17,9 Prozent. Und so wie es aussieht hat sich dieser Trend eher noch verstärkt.
Kenner beobachten die Verjüngung der Szene schon seit längerem. Ein Head-Shop Besitzer erzählt: „Erst gestern kam hier ein maximal 15-jähriger rein, der einen Bong für die Tasche haben wollte. Der Typ war komplett sediert und fragt auch noch nach einem Gerät, dass er mit in die Schule nehmen kann. Damit ist er jetzt wahrscheinlich der Held in der Klasse.“ Insgesamt sei zu beobachten, dass die Käufer von Paraphenalia über die Jahre jünger geworden sind.
Die spannende Frage ist nun, welche Auswirkungen der Genuss von Cannabis hat. Darüber gehen die Meinungen auseinander, die empirischen Erhebungen im Bundesgebiet unterstützen die These vom kranken Kiffer allerdings nicht. Ein paar Zahlen: Im Jahr 2000 lag der Anteil der aktuellen THC-Liebhaber in Deutschland zwischen fünf und sechs Prozent. Hochgerechnet auf die Wohnbevölkerung sind das in Ostdeutschland 26.000 Personen und in Westdeutschland 214.000 Personen, die regelmäßig Cannabis konsumierten. Glaubt man den Erhebungen weiter haben nur wenige Kiffer Probleme mit ihrem Inhalationssport.
Die größte Studie zu dem Thema von Kleiber und Kovar kommt in feinstem Wissenschaftsdeutsch zu dem Schluss: „Was die Auswirkungen von Cannabis auf die psychische Gesundheit anbelangt, muss aufgrund der vorliegenden Ergebnisse die Annahme, dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit nach sich zieht, zurückgewiesen werden.“ Fest steht auf der anderen Seite, dass diejenigen Menschen, die heute Dauerkiffer sind ihre ersten Erfahrungen relativ früh gemacht haben. Mit anderen Worten: Je früher man anfängt zu knastern, desto größer ist später die Chance dauerstoned durch die Gegend zu eiern.
Wie geht man nun mit dem jugendlichen Fans von Cannabis, Alkohol, anderen Genussmitteln und sogenannten Drogen um? Im Kern stoßen dabei zwei Auffassungen aufeinander. Die eine: Weil alle Rauschmittel das Potential zur Verstärkung und Wiederholung in sich tragen, muss das Ziel die Erziehung zur Abstinenz sein. Die Gefahr, die von der Integration des Drogenkonsums in die Gesellschaft ausgeht, zeigt sich deutlich am Alkohol. Die andere: Eine drogenfreie Gesellschaft ist nicht nur unmöglich, sondern durch ihre prohibitiven Zwangsmaßnahmen zugleich ein teilweise totalitärer Staat. Ziel muss daher die Erziehung zur selbstverantwortlichen Haltung und Handlung sein. Aus der Diskussion ausgespart bleibt meist die betroffene Gruppe, nämlich die, die ab und zu Cannabis zur Entspannung und zur Rekreation nutzt und eigentlich nur ein Problem hat: Dass die Produkte der Pflanze auf dem Markt erscheinen ohne auf Qualität geprüft worden zu sein.
Die Garde der Therapeuten, Suchtberater und Schulpsychologen steht vor dringenderen Problemen. Ihrer Meinung nach setzt das Betäubungsmittelgesetz der Beratungs- und Aufklärungstätigkeit enge Grenzen, zum anderen ist die Unkenntnis über Wirkungen und Auswirkungen von Gras und Hasch unter Lehrern, Eltern und Schülern riesengroß. In den Worten des Psychologen am Telefon: „Die Schule kann bei der momentanen Gesetzeslage keine Anleitung zum regelgeleiteten Konsum geben, und das kann auch nicht Auftrag der Schule sein.“ In der persönlichen Beratung von Schülern allerdings würde nicht nur auf Abstinenz abgestellt, „das wäre völlig unrealistisch“. Auf Veranstaltungen zum Thema Drogenkonsum würde immer wieder die Unsicherheit deutlich werden, die allenthalben unter Eltern, Lehrern und Schülern herrsche. „Zumeist wird der Cannabiskonsum total dramatisiert, andere spielen ihn vollständig runter.“ So oder so sei das Thema enorm emotional besetzt. Fazit des Psychologen: „Versachlichung und Aufklärung tuen Not.“
Bei der Veranstaltung „Jugend im Parlament“ berichteten Hamburger Schüler den Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft im Jahr 2000 von ihren Erfahrungen mit kiffenden Mitschülern. Die Überraschung: Die meisten Jugendlichen teilten mit, sie hätten bisher bei keinem ihrer Mitschüler Verhaltensauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen der Leistung durch die Einatmung von geschwängerten Rauch festgestellt.
Im Regelfall würde Cannabis ohnehin in der Freizeit konsumiert, weiß Gert Herweg, der in Frankfurt als Fachberater tätig ist. In der Metropole haben seiner Einschätzung nach bis zu 20 Prozent der Schüler über 14 Jahren Erfahrungen mit Cannabis. Die meisten davon würden den Hanf aber nur probieren, wenige würden zu Gewohnheitsrauchern. Im gesamten Bundesgebiet ist zu beobachten, dass vor allem Schulen in sozial schwachen Wohngebieten von Problemen mit dauerkiffenden Jugendlichen berichten.
Misst man nicht mit ökonomischen Maßstäben, stellt sich die Frage nach den Vor- und Nachteilen des Drogenkonsums noch einmal anders. Was kaum einer der Therapeuten und „Drogenexperten“ auszusprechen wagt, ist doch, dass Cannabis und andere Rauschmittel bei vernünftiger Anwendung eben durchaus zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit beitragen können und nicht nur wie ein unablässig wachsendes Geschwür dieselbe zerfressen. Sicher, die Gefahren eines allzu frühen Konsums liegen auf der Hand: Sie bestehen in einer, bildlich gesprochen, Aufweichung einer Plattform, die man sich ja gerade erst -unabhängig von den Eltern- schaffen will. Gleichwohl gilt: Fatal ist doch die zeitweise Ausrichtung des jungen, sich entwickelnden Wertesystems an einer Droge nur dann, wenn der Mensch sich dadurch entweder unglücklich macht oder seine Verantwortung für das natürliche und soziale Umfeld auf längere Zeit negiert. Diese Gefahren bestehen, sind aber nach überwiegender Meinung eher vom Elternhaus und dem Freundeskreis abhängig als von Pflanzenextrakten.
Neugierde und Entdeckerdrang, Abgrenzung zu Autoritäten und das Erleben von Freiheit sind notwendige Bedingungen des Erwachsenwerdens. Sicher tut man der gedeihenden menschlichen Natur nicht zu sehr Gewalt an, wenn man einige Genussmittel per Gesetz kategorisch aus ihrem Erlebnishorizont streicht. Auf der anderen Seite lauern die Gefahren der blinden Konsumwut überall und in der propagierten „offenen Gesellschaft“ sollte es eben auch darum gehen, den Umgang mit diesen zu lernen. Aber wer lehrt diesen, angesichts überforderter Eltern, nicht legitimierter Schulen, die zudem ihren Ruf im Viertel nicht verlieren wollen und einem Freundeskreis, der zur Verharmlosung neigt?
Jörg Auf dem Hövel