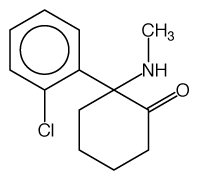Interview mit Hans-Christian Dany über die Aktualität der Figur des Dandy
Seine Eleganz erscheint mühelos, zugleich können seine spielerische Irritationen in den Zeiten des Übergangs helfen. Begleitend zur Ausstellung „No Dandy, No Fun“ in der Kunsthalle Bern haben Hans-Christian Dany und Valérie Knoll ein Buch über eine noch immer moderne Erscheinung geschrieben.
Jörg Auf dem Hövel
Frage:
„Mode-Geck mit fünf Buchstaben“, fragt das Kreuzwort-Rätsel. Welchem Irrtum sitzt man auf? Warum ist der Dandy so eingeflossen in das allgemeine Bewusstsein?
Hans-Christian Dany:
Es gibt eine allgemeine Vorstellung von einem Mode-Geck, also von jemandem, der Übertriebenen, dabei gar nicht unbedingt modisch, eher konservativ gekleideten Herren, der elegant ist, Einstecktuch trägt. Das sind Adaptionen von der Urfigur des Beau Brummel. Interessanter schien uns die Denkfigur, die dahinter verborgen ist und durch die im 19. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung die Figur des Stoikers weitergedacht wurde. Also eine Figur, die sich eher in Askese übt, die sich nicht mehr farbig angezogen, sondern schwarz-weiß.
War das so?
Der Adel des ausklingenden 18. Jahrhunderts hat sich ja noch sehr farbenprächtig gekleidet. Und da taucht dann Brummel um die Jahrhundertwende auf. Er hat als sozialer Aufsteiger auch gar nicht die Möglichkeiten sich wieder Adel zu kleiden und muss eine andere Art von Eleganz erfinden.
Warum war die Zeit reif für so eine Gestalt?
Die französische Revolution löste eine große Verunsicherung aus, auch in den Ländern, die noch weiter feudalistisch waren. Und diese Verunsicherung macht er zu seiner Bühne. Im Bürgertum verankert gibt er sich aber eben nicht damit zufrieden, der Bürger in der zweiten Reihe zu sein. Und er sieht nicht ein, dass er sich fleißig hoch arbeiten soll. Er findet in der Verunsicherung des Hofes und des Adels seine Dramaturgie.
Zugleich schien sein Auftritt für sich selbst nur gelungen, wenn er nicht zu sehr auffiel. Er wollte nicht den Paradiesvogel spielen. Aber was wollte er zeigen mit seinem Äußeren?
Seine Ziele sind nicht offengelegt, er ist eine Spieler- oder auch taktische Figur,, eine Figur in einer Zeit des Übergangs, was ihn heute wieder so interessant macht. Also eine Gesellschaft transformiert sich und keiner weiß wirklich, wo es hingeht. In Frankreich war es zu dem Zeitpunkt nicht klar, wohin die Revolution führen würde. Und deswegen ist die Figuar des Dandy jetzt so interessant. In einer Zeit des Umbruchs, die kaum größere Ziele kennt, aus dem Erhalt des Status quo.
Schriftlich hat er gar nichts hinterlassen?
Es gibt ein paar Gedichte. Aber es gibt kein Manifest. Er ist ein moderner Mensch, der weiter geht, aber anders als die Avantgarden nicht mit einem erklärten Ziel.
Und der Unterschied zum Snob?
Der Snob sagt ja zu den existierenden Statussymbolen. Also er übertreibt es mit denen, es kann nur der beste Champagner sein. Der Dandy spuckt diesen aus und sagt, der schmeckt wie Pisse. Der Snob versucht mitzuhalten – und das tun Dandys gerade nicht.
War die Kurtisane ein Vorbild für den Dandy?
Das ist eine Überlegung. Es gibt diese Figur der Kurtisane als einer sozialen Aufsteigerin, die in diesen feudalen Gesellschaften lebt, als Geliebte oder auch als potenzielle Geliebte. Sie entwirft neue Moden und zeichnet sich durch ein freches Mundwerk aus. In einer an Macht gewöhnten Gesellschaft ermächtigt sie sich dazu, diese zu beleidigen. Und da ist natürlich das Nichtstun, sie haben viel gewartet, gingen keiner Arbeit nach. Das unterscheidet sie und die Dandys von den Aufsteigern, die sich hocharbeiten müssen. Der Dandy wird männlich wahrgenommen, dabei gab es weibliche Vorbilder.
Eine Mehrzahl von Dandys waren biologische Männer, die Frauen sein wollten.
Brummel war schwul, er selber stellte sich aber als asexuell dar. Das war eine Fassade, zu der er genötigt war, um nicht diskriminiert zu werden. Der Dandy nutzt als weiblich identifizierte Techniken, um mit den Betrachter zu spielen.
Anders herum konstruieren weibliche Dandys sich männlich?
Oder sie entwerfen als eine Art Nicht-Geschlecht. Die Künstlerin Hanne Darboven ist so ein Beispiel. Sie modellierte sich im Laufe ihres Lebens zu einer Figur zwischen Mann und Frau. Zudem spielt sie mit einer Form von Arbeit mit einem ungeheuren Fleiß, der aber ins repetetiv-groteske verzerrt wird. Sie übersetzt die Arbeit der hanseatischen Pfeffersäcke zu einer vorkommen leeren, in sich perpetuierenden Kunsttätigkeit. Wir haben uns ja hauptsächlich beschäftigt mit einer bestimmten Generation von Konzeptkünstlerinnen. Jemand wie Lutz Bacher zum Beispiel, die durch ihr Pseudonym in einer fiktiven Männeridentität gelebt hat und sehr damit gearbeitet hat, dass ihr Werk immer wieder diejenigen, die glaubten es zu kennen, verblüfft hat.
Das Nichtstun der Dandys ist als eher eine bewusste Nicht-Berührung der Welt um nicht noch mehr Müll zu hinterlassen?
Jemand wie Marcel Duchamp hat es als Künstler vermieden viel zu tun und ist zu einer der sichtbarsten Personen überhaupt geworden, mit sehr wenig hergestellter Materie. Dandys wie er haben Umgangsformen mit der Welt erfunden, die angesichts der ökologischen Probleme unserer Gegenwart aktuell sehr angemessen wirken. Also nicht mehr die Zukunft zu planen, nicht mehr immer weiter etwas hinzustellen, sondern Dinge, die schon da sind, wieder aufzugreifen und zu remodellieren und vielleicht für eine kommende Zeit in angemessener Form wieder herzustellen. Darum scheint uns der oder die Dandy eine faszinierende Figur der Moderne, die ganz viele Eigenschaften und Taktiken hat, die angesichts der heute klar erkennbaren Grenzen oder gar der Furchtbarkeit der menschlicher Planung, wieder Relevanz hat.
Durch Faulheit das Leben in die Hand nehmen, das klingt nach Punk.
Diese No-Future Episode, die sehr Dandy war, ist ja vielleicht auch eine der stärksten Unterbrechungen gewesen im letzten halben Jahrhundert. Um zu sagen, Halt, nachdem die Endlichkeit der industriellen Moderne kurz zuvor prognostiziert wurde. Wenn wir so weitergehen, dann gehen wir in den Untergang.
Friedrich Merz würde jetzt natürlich die Frage nach dem Sozialschmarrotzertum stellen. Der Dandy, auf wessen Kosten hat gelebt?
Wohl so wie moderne Staaten auf Pump. Er lebt so wie Friedrich Merz lebt. Brummel hat auf Pump bis zum Bankrott und später von fast gar nichts gelebt. Es geht schon darum mit sehr wenig, sehr viel zu machen, da ist bei Friedrich Merz noch viel Luft nach Oben. Während beim Dandy eine Negation der Werte da ist. Und dieses Ablehnen der Werte unserer Zeit ist ja vielleicht auch sehr angebracht. Es ist ja richtiger nach Bad Gastein zu fahren als nach Bali zu fliegen. Oder gar nicht weg zu fahren. Der Dandy hat keine Problem damit Erbschaften durchzubringen. Wir haben heute doch die fatale Entwicklung, dass sich eine Klassengesellschaft über Erbschaften erhält. Der Dandy ist geübt darin den Ast abzusägen, auf dem er sitzt.
Pflegt der Dandy im Bedarfsfall seine Mutter?
Charles Baudelaire, der große Theoretiker des Dandytums, pflegte auf jeden Fall jahrelang seine kranke Frau. Eltern sind hingegen eher etwas, womit der Dandy es nicht so hat, da er das Zweifelhafte der Herkunft und ihrer Erbfolge in Frage stellt. Woher man stammt, wird undurchsichtig gehalten oder die Spur davon, das Erbe verprasst, damit es weg ist. Trotzdem gibt es fürsorgliche Dandys und auch die Sorge um sich, zielt bei dieser Haltung nie allein auf sich selbst, sondern immer vor allem darauf, wie dieses Selbst Teil an der Gemeinschaft wird.
Aber der Dandy will doch gar kein Teil der Gemeinschaft sein.
Doch, er will in Kontakt treten. Das sind andere Formen als die, der auf Verständnis und Konsens bauenden Gesellschaften der Gegenwart, in denen fast jeder Dissens zu Rückzug und Abgrenzung führt. Dandys gehen nicht davon aus, nur wenn wir zur Übereinstimmung kommen, sind wir in Kontakt. Eher treten wir in dem Moment, in dem ich nicht mit dir übereinstimme und ich dich vor den Kopf stoße, in einen Austausch mit den anderen. Und in dem Moment wo ich eigentlich auch verschwinde in unserem Austausch, können wir überhaupt erst in Kontakt treten. Dandys sind permanent mit Zügelung und Zurücknahme ihres Ichs und ihrer Subjektivität beschäftigt, bis hin zur Auslöschung. Immer wenn ihnen etwas im Gespräch zum Konsens erstarren droht, werfen sie ihre Position über den Haufen, um dem in der Übereinstimmung müde gewordenen Austausch wieder neues Leben einhauchen. Das Gegenüber wird gerade im Widerspruch anerkannt.
Das herrschende Bild des Dandys ist doch eher der Egozentriker, der nur um sich selbst kreist.
Die Sorge um den eigenen Auftritt ist aber immer eine Reaktion auf das Gegenüber. Ein Dandy entwickelt meinetwegen einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Art seine Art seine Krawatte zu binden und die anderen adaptieren das. Und dann ist der Begriff der Gemeinschaft nicht, wir tragen jetzt alle die Krawatte gleich, sondern trage sie gleich wieder anders und trete dadurch wieder ich in Dialog den Dialog mit euch. Es geht nicht darum, sein Ich zu verfeinern, sondern die Herstellung von Gemeinschaft im Unterschied und der Unterbrechung des Konsens. Es ist ja ein Scheindialog, wenn wir alle uns zum Beispiel auf die gleichen Statussymbole einigen. Dann wird abgeglichen mit der Folge zu sagen: Meine Statussymbole sind noch etwas besser als deine.
Gibt es Parallelen zur spirituell-esoterischen Ich-Auflösung als heilsamem Weg des Mensch-Seins?
Der Dandy ist es ist durchaus eine spirituelle Figur. Das hat häufig damit zu tun, das Nichts und die Leere zum Strahlen zu bringen.
Feingeistigkeit, Wissen, der Willen zur Irritation. Fühlt man sich als Gegenüber vom Dandy schnell profan?
Dandys begreifen das Gespräch als ein gemeinsames Lernen, indem auch gesagt gesagt werden, nein, deine Antwort ist unzureichend und langweilig, da sie vorhersehbar war. Da kann ich auch mit ChatGBT reden. Ein Gespräch unter Dandys heißt schon eine andauernde Forderung gegeneinander. Aber wenn wir eine Gemeinschaft bilden wollen, dann müssen wir schon etwas von uns selbst und unserem Gegenüber verlangen.
Hans-Christian Dany, Valérie Knoll
No Dandy, No Fun
Looking Good as Things Fall Apart
Gutaussehend in den Untergang
2023
11.5 x 18cm, English 232 pages and German 240 pages, 30 b/w ill., softcover
ISBN English 978-3-95679-561-9
ISBN Deutsch 978-1-915609-16-8
Beim Verlag bestellen