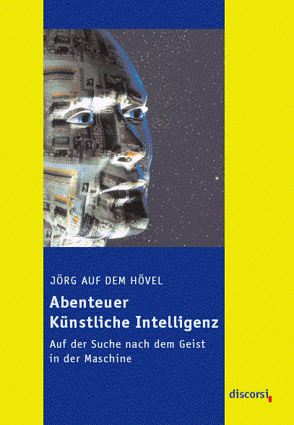Im Buschbrand der gegenseitigen Abhängigkeiten von Freizeit-Fabriken, Promis und Journalisten.
Der dunkle Anzug ist zu warm, schwitzend wanke ich in den Fahrstuhl. Abfahrt zum Bussi-Bussi. Ich weiß nicht, was mich auf der Terrasse des verbrauchten Strandhotels erwartet. Nun gut, den offiziellen Anlass habe ich erfahren: es geht um das Stopfen von nahe gelegenen 18 Löcher im Rasen – ein Golfplatz wird eröffnet. Dafür müsste man sich nur eine halbe Stunde nehmen, hier aber haben sich für die nächsten drei Tage A- und B-Promis aus der gesamten Republik angekündigt. Dazu sind Vertreter aus den Hochglanzmedien und PR-Berater angerauscht. Sie alle wollen in einem norddeutschen Seebad den Knospen ihrer Zunge folgen, Sonne anzapfen und ihren Hüftschwung justieren, kurz, sich auf Nass verlustieren, vulgo: die Eier schaukeln lassen.
Um der Situation gewachsen zu sein, habe ich meinen Kahn mächtig mit marokkanischen Pfefferminzblüten vollgeladen und meine liebliche Begleiterin sitzt im gleichen Boot. Gleißend brennt daher die Abendsonne auf die Kieselsteinplatten, auf denen 50 Paar schwarze Schuhe scharren. Eine Sonnenbrille wäre kommod, wohl aber ein zu deutliches Zeichen gewollt-cooler Distanz. Die PR-Dame kommt auf uns zugewieselt, „ahh, die Hamburger, hier rüber, kommen sie hier rüber, zur Hamburger Gruppe“. Flugs haben wir einen Sekt in der Hand, perlendes Gold, das Fraktale auf das Kleid meiner Muse wirft, und werden zu sechs Stehgeigern bugsiert, die in Plauderhaltung im Kreise stehen. Dieser öffnet sich den Fremdlingen, aber aus dem Auge des Zyklons weht kalter Wind uns entgegen. Man gibt sich vornehm, eine probates Mittel die eigene Unsicherheit zu tarnen. Von Hochlandgemüse innerlich aufgewühlt auf unbekannte Mitbürger zu treffen, birgt immer die Gefahr unfunky drauf zu kommen. Mund und Magen wollen rülpsend tief empfundenen Dünnsinn von sich geben, während der innere, rationale Obermufti und Bedenkenträger Befehle der sozialen Normen brüllt. Rechnen kann man nicht mehr, aber zurechnungsfähig will man sein. Anders ausgedrückt: Kiffen kann unsicher machen. Objektiv betrachtet eine drollige Zwickmühle, in der konkreten Situation ein Abenteuer, was schon für manchen Horrortrip sorgte.
Erfahrung tut hier Not, so weiß ich, dass ich mich zwar wie Fidel Castro fühle, aber nicht so aussehe. Mein Sektglas wirkt dabei wie eine rettende Rehling im Sturm. Smalltalk. Ein Blick in die Runde und plötzlich nimmt eine innere, alte Kraft von mir Besitz. Entgegen aller ungeschriebenen Gesellschaftsverträge spüre ich Begeisterung aufwallen, ein Gefühl von Jugend, eine Erinnerung an sportliche Ekstase, an Männerschweiß, an den von meiner Oma gestrickten Fanschal; dazu jucken ausnahmsweise nur meine Füße. Zusätzlich bin ich erleichtert über den alsbald folgenden, hoffentlich entkrampfenden Integrationsakt in die illustre Runde. Viel zu laut platzt es feucht aus mit heraus: „Das ist doch Manni Kaltz!“ Köpfe drehen sich, Aufmerksamkeit ist gesichert. Ich merke das nicht, überbrücke mit einem Ausfallschritt das Auge des Zyklons und stoße mein Glas an das meines überraschten Gegenübers. Ein klicken, ein sprudeln, ich fahre fort: „Wie geil, Manni Kaltz, ich glaub´ das nicht.“ Der Mann mit dem sauber gekürzten Vokuhila bleibt ruhig, denn „der Manni redet nicht so gerne“, wie ich später erfahre.
Schweigen, leichtes Entsetzen sogar, aber mein Verzücken kommt weiter in Rage. Ich stoße meiner schönen Begleiterin mit dem Ellbogen in die Seite, zeige mit dem Glas auf den Fußball-Heroen und fahre fort: „Ahh, das waren noch Zeiten, sie auf Rechtsaußen, dann Banane, und dann das Fußballungeheuer, hach, so wird heute gar nicht mehr gespielt. Unvergesslich, das 5:1 gegen Real Madrid. Zwei Dinger haben sie da reingesemmelt, oh Mann, wie geil.“ Doch der Flankengott, der 69fache Nationalbuffer, die Legende vom HSV, dieser Manfred Kaltz, brummelt nur einige undeutliche Worte und so langsam komme ich von meiner Wolke runter. Die Menschen um mich sind verstört, peinlich berührt. Sollte man einen dieser Fußball-Proleten im Nest hocken haben?
Ehrliche Begeisterung, so steht nach zehn Minuten fest, ist hier nicht gern gesehen. Und was noch wichtiger ist: Promis – und solche, die es sein wollen – spricht man nicht an. Sie sind froh sich mit Ihresgleichen zu sonnen, im Saft ihrer Erfolge zu schmoren. Wohlgemerkt gilt dies nicht für Manni, der Mann will einfach nur seine Ruhe haben, ihm ist Radau um seine Bananenflanken lästig.
Der Ausbruch war kurze Raserei, ich trete einen Schritt zurück. Die Augen meiner Begleitung liegen verträumt-ironisch auf mir, der Halbkreis aus Frührentner schließt sich wieder und wir stehen außen vor. O.k., das war´s erst einmal. Nebenbei hat der Direktor seine Rede an die golfende Nation begonnen, er preist die knöcherne Eichenkultur der Hotelkette. Die verdiente Vor- und Mitten-im-Kriegsgeneration ist in den Häusern hängen geblieben, dazu passt eigentlich nicht der Porno-Kanal, der auf unserem Zimmer nach jedem dritten Schaltvorgang erscheint. Wahrscheinlich wichst Opi sich den Wicht, während Omi bei der Pediküre weilt.
Wie gerufen wackelt plötzlich Elke S. ins Bild, blonder Star der 70er. Die spielt auch Golf? Nein, sie ist Schmuck, soll der prüden Rasenweihe Glamour und damit Nennung in den bundesweiten Magazinen garantieren. So ergibt sich der Sinn der Geselligkeit: Die Freizeit-Fabrik schiebt sich ins Bewusstsein der Kunden und die Prominenten bleiben im Gespräch, denn davon leben sie. Die anwesenden Journalisten salbadern Gutes über die Melange und übermitteln im Nebensatz die Koordinaten des Geschehens. Die Public-Relation-Dompteure behalten die Käfigtür im Auge. Und der Clou: Alle zusammen verbringen ein weiteres preiswertes Wochenende.
An diesem Kuchen will auch ich nagen, aber mein fußballhistorischer Ausfall hat uns schon nach zehn Minuten zu Parias werden lassen. Egal, gleich gibt es Diner. Der freundliche Direx lädt ein. Die Stimmung ist gut, man kennt sich von vielen anderen Jubelfeiern. Es ist die gemeinsame Leidenschaft aller derer, denen beim Tennis zu viele Rohlinge rumlaufen. „Haben sie noch Sex oder golfen sie schon?“ Wir sitzen am selben Tisch wie Manni, der aber lässt mir, seinem getreuen Fan, keinen Blick zukommen. In mir spielen die beiden Mannschaften von FC Bekifft-Ergötzlich und der Spielvereinigung Peinigend-Stoned einen harten Ball gegeneinander. Noch steht es 1:1, aber Peinigend-Stoned übt enormen Druck auf die Verteidigung von Bekifft-Ergötzlich aus.
Das Essen beruhigt unsere Gemüter, auch meine Begleitung erlangt so langsam ihre Fassung wieder. Meine Tischnachbarin, die Redakteurin einer TV-Zeitschrift, parliert zutraulich, schon fühle ich mich besser. Aber ich bin getäuscht worden, übel sogar. Denn der Mann der Dame, irgendeine Schauspielgröße, dessen Name ich vergaß, fragt sie, was denn das Thema unser noblen Unterredung sei. Nicht wissend, dass ich der Szenerie lausche, winkt sie mit der Gabel ab, zieht die schmalen Brauen hoch und sagt: „Ach nix, völlig uninteressant“. Nun will ich nicht eitel erscheinen, aber das scheint mir doch ein äußerst dünkelhafter und ungebührlicher Reflex auf meine wohl nicht klugen, doch aber warmen Worte zu sein. O.k., das war´s endgültig.
Schade, gerne hätte ich noch weitere Skizzen aus den nun folgenden Tagen gezeichnet. Ich hätte noch berichten können, von nicht geouteten Eiskunstläufern, die beleidigt sind, wenn man sie an den falschen Ecktisch des Festzelts setzt, vom Streit um kühle Austern und von Menschen, die nur (!) über Golf reden können. Aber diese Worte wären dunkel vor Häme, ohne das Licht des freudig-neugierigen Umgangs untereinander. Was also tun? Den Versuch beenden, und vorher noch erwähnen, dass wir lieber am Strand den Wellen folgten, als dort zu sein, wo man sich gegenseitig nur als Spiegel der eigenen Großartigkeit dient.