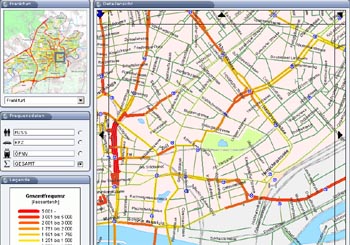Warum München die Hauptstadt Deutschlands ist
Oktober 2005
Sonnenpfützen schimmern auf Sitzflächen. Ein Cafe in Hamburg, Stühle und Bänke stehen vor der Fensterfront, Linden tröpfeln ihre klebrigen Tränen. Zum Espresso wird ein Glas Wasser gereicht, Tageszeitungen mit Holzhalter liegen auf den Tischen, hier bleibt man sitzen. Frank, ein Dreißiger mit wenig Haaren, hält mit dem Fahrrad an. „Ey, Frank, alter Lappen, was geht ab?“, tönt es fordernd neben ihm. Es ist Mark, ebenfalls in den ersten Zügen der 30, mehr Haare, nicht so dünn wie Frank, aber auch diesen stoppeligen Halbbartwuchs, Cordhemd in blau, alte Jeans, Clocks an den nackten Füßen. „Du bist zu spät“,
„Na und?“,
„Ich freu mich auch, dich zu sehen“.
Ein Aufstehen, ein Fahrradabschließen, ein Zugehen, eine Umarmung. „Erzähl!“
„Was denn?“
„Witzbold, wie war’s in München, du warst fast zwei Jahre dort. Also wie war´s? Wohnen, wo andere Urlaub machen? Oder was?“
„Es sei bei dir anders, aber ansonsten fällt mir auf, dass alle, die diese Frage stellen, ohnehin nur ihre Vorurteile bestätigt oder widerlegt haben wollen. Wer fragt heute schon noch, um dann zuzuhören? Aber ganz abgesehen davon, wie soll man ohne Vorurteile in eine Stadt einziehen? Denn Wünsche hatte ich nicht an die Stadt, ich wusste, es wird gut werden, weißt schon, wie ich meine. Schließlich bin ich es, der da hingeht.“
„Ja, ja, versteh schon, aber einen Batzen von schon mal Gehörtem bringt doch jeder mit in seine neue Bleibe. Normal.“
„Wir haben alles gehört: <München ist ein Dorf>, und <München ist spießig, aber das Umland ist toll>. Bei mir kam noch etwas dazu, das über Vorurteile hinaus ging, nämlich eine Abneigung gegen katholische Lehren und den damit zusammenhängenden Obrigkeitsglauben, der aus meiner Sicht von der Kirche aus seit Jahrhunderten virusartig auf das soziale Gefüge der bayerischen Gesellschaft übergegriffen hatte. Na ja, so ähnlich.
Um es schnell loszuwerden: Und irgendwie war es auch genau so, aber irgendwie war es genau anders. Keine Angst, es folgt jetzt keine differenzierte Abwägung von Gut und Schlecht für München, sondern es folgt eine hemmungs- und erbarmungslose Niedermachung einer Stadt, über der der Materialismus wie eine schwangere Blase hängt und das Licht der funkenden, selbstgenügsamen und daher zunächst immer auch nicht profitorientierten Idee für Jahre und vielleicht Jahrzehnte verdunkelt.“
„Na, das ist doch ein Scherz, es gibt auch in München Künstler und andere Penner.“
„Das war Mal. Gleich zu Beginn unserer Zeit dort ist Louis Marzaroli gestorben, ein Künstler aus Schwabing. Wenn ich traf, warnte er mich vor München. Sicher, das lag auch daran, das er auch privat nicht glücklich geworden war, aber er behauptete steif und fest, dass die künstlerische Szene in München eine reine Chimäre ist, ein potemkinsches Dorf, dass alle voreinander hin- und herschieben. Und selbst in der Vergangenheit lassen sich doch Beispiele der frustrierten Künstler finden. Lies doch mal Erich Kästners „Hausapotheke“, ein unfreiwilliger, aber furchterregender Beweis seiner Unlust am Leben in der Stadt. Ich sah Louis sterbliche Hülle im Krankenhaus, da passte keine Seele mehr rein, die saß am anderen Ende des Universums, so hoffte ich für ihn, bei Pasta und Rotwein, neben ihr eine schöne Frau.“
Die Bedienung, ein Rotwein, ein Astra, ein einparkendes Auto.
„Wie man sich dem Münchner Naturell am klügsten annähert?, fragst du mich. Das kann ich dir sagen, Mark. Mir reicht der Ausspruch: „Mir san mir“, in der freien Übersetzung so etwas wie <Wir haben’s voll raus>. Das ist der Fachausdruck für eine satte, bornierte Selbstzufriedenheit, gepaart mit krachlederndem Humor, immer rauf auf die Schenkel, har, har; Hauptsache wir bleiben subtil wie ein Panzerkreuzer. Ja, wir Bayern sind geschäftstüchtiger, schlauer, gottgläubig noch dazu! Neoliberale mit Hostienzugang, wenn es den Primat des Mammons nicht schon geben würde, für die Münchner müsste er erfunden werden.
Es ist ja auch kein Wunder, das die so satt sind. Die Verfettung der Bevölkerung ist sichtbar, selbst an heißen Sommertagen sieht man sie in den draußen in Restaurants oder Biergärten sitzen, um in praller Sonne schwitzend Schweinsbraten mit Soße zu fressen, dazu ein Liter Bier in sich reinschüttend und einen Krapfen hinterher werfend. Selbstzufrieden schmatzende, rosige Gesichter sind das, völlig mit dem Braten vor ihnen verschmelzende Zentauren, „Jo mei, is das a Hitz heut“ brummelnd, noch echte Stofftaschentücher aus der Hosentasche ziehend, Wildmosers in Herden, oft auch noch in Kostümen, Entschuldigung , Tracht nennt sich das ja, rumlaufend, „Zahlen, bitte“, kleines Trinkgeld an die Kroatin, das wär ja wohl gelacht, erstmal was leisten, „kann froha sein, dass sie hier ist, joa, hier sein darf (!). Lauter gestandener Mannsbilder und dralle Frauen, immer etwas älter wirkend. „Der hat´s geschafft,“ denkt der Mann und seine Denkblase wandert zum Fahrer des glänzenden Vehikels – „und der da nicht“, denkt sein Kind, das so herrlich brav an seiner Hand flaniert, den Fußgänger nachsehend. Da, mit einem sanften Ruck reißt es sich los, geht kurz ein Stück alleine des Weges, wundert sich über alles neu, wie bunt der Rock, wie schwarz der Mann, wie faltig der Opa, wie grün der Halm aus Plattenwegen. „Vorsichtig, da vorn, komm her“: die Mutter ruft, neu andocken, traute Sicherheit oder auch: hiergeblieben (!), du Wildfang, dich ordnen wir schon ein, und unter sowieso. Nachher gehen wir zu den Stoibers, eine Art Doku-Soap in Bayern, da wirst du lernen, wie man gerade bei Tisch sitzt, du Feuerkopf. Ab in den fetten BMW und davon brausend.“
„Ja, Ja, Frank, ich weiß Bescheid. Ein einziges Würgen.“
„Ja, klar, das sind jetzt Überzeichnungen, Mark, aber was tut das gut. Aber ich bleibe dabei: Nach oben buckeln, nach unten treten, so heißt es dort. Die Stadt bewegt sich zwischen genau zwei Polen: Duckmäusertum und Großmannssucht. Hier wollen sich die Erfolgreichen stets von den Erfolglosen unterscheiden. Letztere, und das ist das Neue, machen dieses Spiel auch noch mit. Sie schauen traurig aus der Wäsche, weil sie nicht so viel von diesem nutzlosen Dreck haben. Eine Kultur des Habens liegt wie eine feucht-schwangere Blase über der Stadt. Tropfen für Tropfen sondert sie ihr Sekret ab und alle, die davon lecken, werden mit einem Virus infiziert und der heißt: Neid.
„Was du Neid nennst, ist wahrscheinlich nur Broterwerb. Aber dir ist ja jede kaufmännische Haltung zuwider. Kaufen und Verkaufen, das ist für dich nur ein anderer Name für elegantes Bescheißen. Und Freude an der Arbeit zu haben ist blinde Unterwürfigkeit. Wenn ich nach deinen Tiraden auch mal etwas Sagen darf: der historische Prozess kennt nur eine Konstante: Veränderung, nicht Beharrung. Und die Welt befindet sich, diese Erkenntnis ist mittlerweile offensichtlich auch bei dir angekommen: im Wandel. Und dieser Wandel, ob wir das wollen oder nicht, ist ein ökonomischer. Und er bestimmt das Bewußtsein.“
„Komm mir doch nicht mit der <Welt im Wandel> Propaganda. Das musst du mir erstens nicht erzählen und zweitens: Das ist doch genauso wahr wie die „ewigen Werte“, und die hast du doch noch vor kurzem immer gepredigt, du Wendehammer. Wie denn nun? Dass das ökonomische Sein das Bewusstsein bestimmt, das kommt ja Gott sei Dank nicht von dir, sondern vom dem Mann mit dem Bart, aber auch hier gilt: Umgekehrt wird der zweite Schuh draus. Soll heißen: Wenn ich die Welt als gigantischen Tauschhandel sehen will, dann wird sie mir auch so erscheinen. Man stelle sich die Anwendung dieser Theorie auf alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens vor. Na, vielen Dank. Die Ökonomie unterliegt kulturellen und noch tausend anderen Bedingungen. Kapitalismus ist heute in erster Linie Konsumkapitalismus, im dem es um den Verkauf von aus meiner Sicht meist kranken Lebensanschauungen geht. Und vielleicht ist deine Argumentation vom „ewigen Wandel“ nur eine Bejahung des unablässigen ökonomischen Fortschritts, der auf diese Karte setzt.
Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Das, was ich über München sagte, das gilt immer nur abstrakt, immer nur auf die Münchner als Gruppe bezogen. Sobald ich irgendeinen dieser Klöpse persönlich kennen lernten, stellte er sich als zwar sehr direkter, aber durchaus differenzierte Mensch heraus. Das Problem ist nur: meistens kam er oder sie dann gar nicht aus München, sondern war ein „Zugereister“, wie das so heißt. In knapp zwei Jahren habe ich nur zwei Münchner näher kennen gelernt. Einen Maurer aus Harlaching und eine Tischler und Designer aus dem Glockenbachviertel. Sie waren in München geboren, ich war alarmiert, aber trotz bösen Willens konnte und kann ich beiden Stadt-Vertretern nichts anhängen. Geordneter Bierkonsum, der eine wollte sogar kiffen. „Teert und federt ihn“, rufen da jetzt manche, aber die Drogenpolitik des Freistaates ist ein eigenes Thema, so abstrus, so hinter dem Mond, dass ich nicht weiter darüber reden möchte, weil ich mich nicht aufregen soll, sagt mein Arzt. Das erinnert mich an den Junkie, der aus Bayern flüchtete, der vertrug das Klima noch weniger als den schlechten Stoff.“
Ein Winken, die Bedienung: „Noch ein Bier, äh, bitte.“
„Mir auch noch Eines, bitte.“
„Du also wieder in Hamburg. Und hier ist alles besser, oder wie? Hier, wo man bewusst lässiges rumschlomt, ein Kiffergesicht macht und trotz erstklassiger Connection so Straight wie Rumsfeld ist? Hast du den Heroin-Chic der Schanze vermisst, oder was? Nebenbei, München hat eine Uni mit Zehntausenden von Studenten, du willst mir doch nicht erzählen, das die nicht ändern oder auch nur feiern wollen? “
„Ach, den bleibt kaum was anderes übrig, als sich Strähnchen zu färben. Absurd, die Schweinsteiger-Frisuren. Punk für Arme. Der gesamte Fankult um den FC Bayern lässt sich genau daran festmachen. Da geht’s nicht um die Identifikation mit der Seele bayerischer Spielkultur, sondern um die Identifikation mit dem Bankkonto und dem Pokalschrank des Vereins. Die Motzerei des Publikums ist schlimmer als beim HSV. Aber die Grundstimmung der Stadt ist sowieso wütend. Es ist Wut darüber, noch nicht so erfolgreich zu sein wie die anderen, Wut darüber, dass der Verkehr nicht richtig läuft, Wut darüber, dass die Großkopferten doch machen, was sie wollen. Wollte man München mit einem Ton beschreiben wäre es ein motziger Grunzlaut. „Dammischer Dreck“.
„Ich habe nach den Studenten gefragt. Aber egal, du willst mir erzählen die Stadtbevölkerung pöbelt den Tag so munter vor sich hin – so wie du jetzt?“
„Studenten? Da ist ja dagegen die Christian-Albrechts-Universität in Kiel ein brodelnder melting-pot. Wenn die ohne Schlips in der Jura-Vorlesung erscheinen ist das schon Revolution. Völlig konform. Sie atmen die gleiche Luft. Irgendein Museumsdirektor sagte mal: <Wenn man hier in München etwas gut findet, das unbekannt ist, ist das Gotteslästerung. Und wenn man hier etwas gut findet, was bekannt ist, dann ist es ein Hype. Eine interessante Stadt.>
Aber hör hin, ich habe ein Beispiel: Eine alte Oma führte bei uns um die Ecke in den Straßen ihren Hund Gassi. Wahrscheinlich pinkelte er ihr nicht schnell genug, auf jeden Fall motzte sie ihn die ganze Zeit an: „Du Saubuab, du dammischer Saubuab, jetzt komm hinni, du Saubuab.“ Ihre Tonlage vibrierte zwischen Aggression und Zuneigung, sie konnte ihre Liebe zu dem Tier nur in zeternder Form ausdrücken.“
„Das musste dir doch entgegen kommen.“
„Witzbold, ich pöbel vielleicht auch gerne, vielleicht um meinen Weltschmerz zu befreien, aber in mir wohnt doch keine aggressive Grundstimmung gegenüber den Dingen dieser Welt. Na, sei’s drum. Ich will hier jetzt auch gar nicht den Münchner das Gefühl für’s Schöne absprechen, aber es ist immer alles so brachial. Anstatt sich wie die Leute auf dem Land ihren Ursprüngen bewusst zu sein, denken die Freaks sie wären die Aufsteiger. Bei jedem Fest riecht es nach tumber Bauerntümelei, da vereint sich die motzende Grundhaltung mit kräftiger Fröhlichkeit und heraus kommt bestenfalls eine „zünftige Rauferei“, wie die das dann nennen.
„Du lässt ja kein gutes Haar an der Aktion. Wie bist du denn dort zwei Jahre durch die Gegend gerannt? Erzähl doch Mal was Positives!“
„Schwer, wenn man nicht kitschig werden will. Willst du was über die Landschaft hören, die fruchtbar-furchtbar, unfassbar schönen Berge?“
„Auch, aber lieber was aus der Stadt. Von den Menschen.“
„O.k., was ich sagen kann: Die Dickköpfigkeit der Münchner ist in gewisser Hinsicht charmant, denn sie ist kommunikativer als die Sturheit der nordischen Schlickrutscher. Im Biergarten kommt es schnell zum Erstkontakt mit den Aliens, ich sag’s dir. Das eine Mal saßen wir in einem solchen Garten unter Kastanienbäumen. Die Sonne schien, es war warm, brennend heiß sogar, aber unter den Bäumen war es kühler. Ein paar Metal-Freaks sprachen Tina und mich an. Der eine Langhaarige zeigte sich im Laufe des Gesprächs begeistert über den von uns auf dem Flohmarkt erstandene Salat-Schleuder. Aus seinem gepiercten Mund kam der Satz: „Die meisten Leute wissen ja nicht, dass ein feuchter Salat das Dressing überhaupt nicht richtig annehmen kann.“ He, he.
Ein anderes Mal saß ich alleine im Biergarten des Englischen Gartens, beim Chinesischen Turm. Ein Rentner hatte es sich auf der Bank schon bequem gemacht, es war Nachmittags, die Sonne schien mal wieder und sein Klappfahrrad stand direkt neben ihm. Ich setzte mich zwei Plätze neben ihn, wir schwiegen. Oben auf dem Turm spielte eine Kapelle, in Tracht, weißt du, täterä. Blasmusik, aber auch Interpretationen von bekannten Hits aus den 50ern. Na ja, nach der ersten Maß Bier tippte ich leicht mit den Fußspitzen mit. Der Rentner zog sich seine zweite Maß rein und blinzelte in die Sonne. So verging eine Stunde, vielleicht etwas mehr. Ich war bei der dritten Maß angelangt, die hatte ich aber schon als Radler panaschiert. Kleine Bläschen formten sich über meinem Kopf. Die Band spielte. Langsam wandte sich der Rentner zu mir, grinste, und sagte: „Is’ a herrlich Sach’ heit.“
“Mehr nicht?“
„Mehr nicht. Und ich konnte auch nicht antworten, ich war zu beeindruckt von seiner Weisheit, denn besser konnte man es nicht ausdrücken. Es war herrlich: Sonne, Bier, dazu a Musi; Herz, was willst du mehr?“
„Einfach, aber gut.“
„Gut, weil einfach. So gefallen mir die Bayern am besten.“
„Und dann?“
„Nix dann, irgendwann habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin nach Hause geeiert. Wobei ich keine 100 Meter an der Isar entlang gefahren war, als wieder einer dieser Deppen mich anpöbelte, ich solle auf der richtigen Seite fahren. „Rechtsfahrgebot“, brüllte er. „Rechtsfahrgebot, wenn ich das schon höre, so eine biedere Klugscheißerei.“
„Jetzt kommst du wieder ins Pöbeln.“
„Ach, ist doch wahr. Und weißt du, woran das liegt? Radfahrer sind die ursprünglichen Verlierer in München. Das Auto hat Vorfahrt, wenn nicht nach den Verkehrs-, so dann doch nach den sozialen Regeln. Fahrradwege, so meine Meinung, sind hier und meinetwegen auch anderswo nur Abschiebungsmaßnahmen, nur dazu da, den Fluss der Abgasheinis nicht zu stören. Und um der drohenden Abdrängung ins soziale Abseits entgegen zu treten, bedienen sich die Radler des üblichen bayrischen Tricks: Sie rüsten auf. Hier wird auf technisch hohem Niveau gegurkt, Gore-Tex am Bein, Carbon unterm Arsch, Fleece über den Schultern. Eine ständige Selbstbehauptung. Und ihr Stück Radweg wird dann auch wieder den strikten Regeln unterworfen. „Falsche Straßenseite“, ich weiß nicht, wie oft ich mir das anhören musste, selbst wenn der Radweg zehn Meter breit war. Der Höhepunkt war als mich irgendein Depp sogar im Wald bei Schäftlarn, einem Vorort an der Isar, anpöbelte, ich solle auf ihn auf der richtigen Seite überholen. Ich voll in die Bremsen, brülle: „Was ist denn nun schon wieder, Mann, Leben und Leben lassen, begreift es doch Mal.“
Aber du wolltest etwas Positives hören. Gleich nebenan von unserer Wohnung am Sendlinger Tor öffnete jeden Morgen um 6.15 Uhr Ida ihren Milchladen. Eine Miniatur-Ausgabe eines Geschäftes, aber mit Herz geführt. Mit Edamer belegte, frische Brötchen, Paninis, Nudelsalate, alles von dem Frauenteam dort selbst gemacht. Eine Goldgrube, zurecht. Manchmal, wenn ich im Hinterhof auf dem Balkon saß, hörte ich die Schläge auf das nackte Fleisch der Schnitzel. Mittagstisch. Jeden Nachmittag um 16 Uhr schloss Ida, aber vorher versammelten sich immer ein paar Leute auf der anderen Straßenseite von dem Laden. Ich wunderte mich zunächst, bis ich mitbekam, das Ida und ihre Frauen die Reste des Tages immer an Hilfsbedürftige verteilten. Sie konnten sich aussuchen, was sie wollten und Ida packte es ihnen in genau die gleichen schönen bedruckten Tütchen, die die anderen Kunden erhielten.“
„Dir blieb anscheinend nur eine schmale Lücke zwischen Naturverherrlichung und Ablehnung der Stadtkultur, etwas abgefedert durch Sozialromantik?“
„Vielleicht. München fördert den Kampf alle gegen Alle, die bleibende soziale Ungleichheit wird durch christliches Mitleid und Fürsorge abgedämpft. Es herrscht das Geld, und die Ideale, die kommen später, auch die <leistet> man sich. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst: <Erst das Brot, dann die Moral>; alles bekannt, aber den globalisierten Kapitalismus gab es doch wahrlich nicht vor dem ersten Erscheinen der Demokratie. Er fußt auf ihr und seine habgierigen Macher sind drauf und dran diese aufzulösen.“
„Ach, Frank, der Humanismus und die Aufklärung ist der geistige Ausfluss eines mit viel Mitteln und wenig Rechten ausgestatteten global kapitalisierten Bürgertums. Das nannte sich Merkantilismus, du Schlaumeier. Und er ist daher nicht ohne Grund in Handelszentren entstanden. Oder auch: Nur weil es schlechte Fußballer gibt, muss ich ja deswegen den Fußball nicht insgesamt Scheiße finden.“
„Es ist wieder nur die halbe Wahrheit, die du da rausstöhnst. Der Humanismus und die Aufklärung sind nur in ihrem bewusstem Rückgriff auf die griechische Philosophie zu verstehen. Muss ich dir das sagen? Und zu deinem Fußballbeispiel: Wenn in den Regeln des Fußballs eine immanente Ungerechtigkeit eingebaut wäre, dann, erst dann, würden wir nicht mehr hinschauen.“
„Die deutsche Wirklichkeit bietet auch in Bayer nachweislich Schwächeren die allergeringsten Aufstiegschancen im Vergleich zu allen anderen, zum Teil viel liberaleren Staaten. Einmal arm, immer arm. Sie ist die Gesellschaft mit den geringsten Geburtenraten. Uns stören die lauten, langweiligen Balgen doch nur. Bei uns sind in 20 Jahren die Hälfte, ich wiederhole: die Hälfte der Menschen über 60 Jahre, also fast alles Rentner. Wir werden ein Seniorenheim. Es gibt noch nicht einmal genügend Kindergartenplätze, die Schulen zerfallen. Bei mir bewerben sich deutsche Abiturienten, die DEVIENITIF der deutschen Sprache nicht mächtig sind – zumindest nicht in schriftlicher Form. Die Wissenschaftler, und zwar nicht nur Gentechniker, verlassen das Land. Ach nö, das ist alles so faktisch, so kalt?“
„Ja, das ist die Form, die ich hören will. Kann ich auch: Dieses Gerede vom Aussterben der Deutschen ist doch hahnebüchen, die sollen doch alle Kinder aus der 3. Welt adoptieren, wenn sie so heiß auf Muttisein sind. Einwanderer rein, heiße Afghanen sollen die 60-jährigen meinetwegen dusselig poppen.“
„Da fällt dir nichts Besseres ein, was? Meiner Meinung nach sind aber nur das die Bereiche, aus denen sich eine Gesellschaft erneuert, und zwar geistig erneuert. Das sind die klassisch-staatlichen Bereiche: Kinder, Jugend, Bildung, Forschung, Lehre. Das gibt es aber hier nicht mehr oder kaum noch. Der deutsche Staat hat dafür kein Geld mehr, weil 6 Millionen Arbeitslose und 20 Millionen Rentner finanziert werden müssen. Und es werden täglich mehr. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass das am Neo-Liberalismus liegt. Komm bitte nicht mit dieser verfickten Platte. Lass dir Besseres einfallen, als Antwort auf diese Herausforderung.“
„Für eine Herausforderung müsste ich nachdenken, das hier schüttel ich so aus dem Ärmel. Erstens: Wieder stellst du mich hin, als ob ich gegen Unternehmertum in jeder Form bin. Blödsinn, aber hinter jedem Unternehmer steckt halt eine Idee, weshalb er den Laden aufmacht und führt. Selbstverwirklichung? Gemeinwohlmehrung? Leben, um zu arbeiten? Arbeiten, um zu leben? Oder aber eben Raffung von Geld, weil er dann irgendwann eben doch dem Geist des Kapitalismus erlegen ist; hier definiert als habgieriges Anhäufen von Besitztümern auf Kosten von Menschen und Umwelt. Das ist das Problem. Wer viel arbeitet, soll viel verdienen, auch einverstanden, aber daran krankt es nicht. Es krankt an den egoistischen Geistern in der Gesellschaft, die ihr Wohl über das aller anderer stellen, nur um sich den dritten Porsche zu kaufen.
Bücher und Reagenzgläser kosten Geld, korrekt. Woher nehmen? Aus den Steuern, korrekt. Wer zahlt die? Wir. Wer oft nicht: Die Großkonzerne. Wer hat sie über Jahre veruntreut? Die von uns gewählten Damen und Herren. Was tun? Ehrliche Politiker wählen, geht nicht, gut. Denn auch Sie denken wieder nur an sich oder sind meinetwegen auch nur gefangen im falschen System.“
„Quatsch. Eine Politik, die sich spät, aber nun immerhin hinstellt und sagt: Wir brauchen mehr Arbeit, mehr Arbeitsplätze. Und leider macht die nicht der liebe Gott und die macht auch nicht der Schröder und die Merkel und auch nicht der Fischer, deren Rotweinkeller sind prallgefüllt, sondern die machen Menschen wie Du und ich oder meinetwegen auch irgendwelche Scheißkonzerne. Alles nur damit der Staat zumindest einen Teil seiner Ausgaben finanzieren kann. Und es müssen alle mit weniger auskommen, die die bekommen und denen, denen es genommen wird. Aber es muss erstmal wieder Menschen geben, denen etwas genommen werden kann, um es denen geben zu können, die es brauchen. Ja, das ist alles profan materiell. Aber Scheiße noch einmal: Das ist doch deswegen trotzdem richtig. Es entspricht menschlichen Erfahrungswerten, wenn ich schon nicht mit Kategorien wie Wahrheit kommen darf. Ich kann das doch nicht alles verdrängen, nur weil es mir noch so gut geht und weil mir die Argumentation nicht gefällt. Was wollt ich sagen? Ach ja: So eine Politik finde ich verantwortungsvoll und ehrlich. Und nicht kalt und herzlos, wie mir irgendwelche ahnungslosen ignoranten Spinner erzählen wollen. Leute, die die Wahrheit ignorieren, verdrängen, verdrehen. Leute, die sich dann auch noch anmaßen, moralisch im Recht zu sein. Gerade auf dieser Anklagebank sitzend, finde ich die Standhaftigkeit einer solchen Politik verantwortungsvoll und ehrlich. Aber Du glaubst nach wie vor am Deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Na denn Prost, solang es hier noch Bier gibt.“
„Ein weiteres unkonzentriertes Scheinargument gysischer Ausprägung.“
„Aber wie waren wir darauf gekommen? Richtig, es ging um München, für dich wahrscheinlich die neue Hauptstadt des am Neoliberalismus leidenden Deutschlands.“
„Stadt ist immer auch ein State of Mind. Und der kollektive Geisteszustand der Stadt ist ein ewiges Zur-Schau-tragen. Und zur Schau trägt man halt nur Erfolg. Der wiederum bemisst sich hier und auch sonst halt vor allem ökonomisch. Und das, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal einhake, empfinde ich als schädlich. Nach München passt dieses Zurschaustellen auch deshalb so hervorragend, weil es historisch eingebettet ist. Erstens in die Architektur: Die Stadt strotzt vor Kulissen und demnach fühlen sich auch alle wie Schauspieler. Ein eitler Maskenball. Zweitens politisch, weil es eine stringente Verbindung vom Wittelsbacher Herrscherhaus, mit so glanzvollen Gestalten wie Ludwig dem Zweiten, über Strauß bis Stoiber gibt. Und der Rest sind Hofstaat, Narren, so wie Mooshammer, und Promis, die den nötigen Größenwahn nur mit ner Prise Koks gebacken kriegen. Es is a Woansinn. Am meisten gefreut hat mich daher der Feinstaub-Alarm. München für ein paar Wochen als Hauptstadt des Rußes in Deutschland. Dabei hatte man sich doch so eine Mühe mit dem Dreck gegeben. Der eine Dreck ins Bahnhofsviertel, der andere ins Hasenbergl. Tja, aber der feine, der ganz feine Dreck, der hat sich halt in allen Ecken der Stadt schon festgesetzt.“